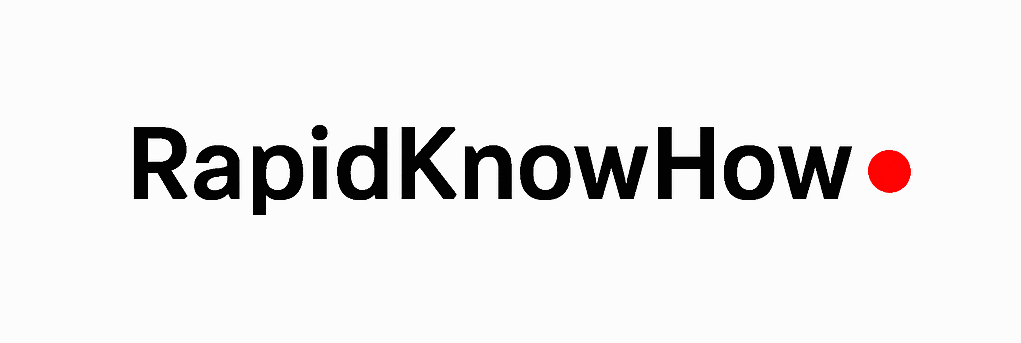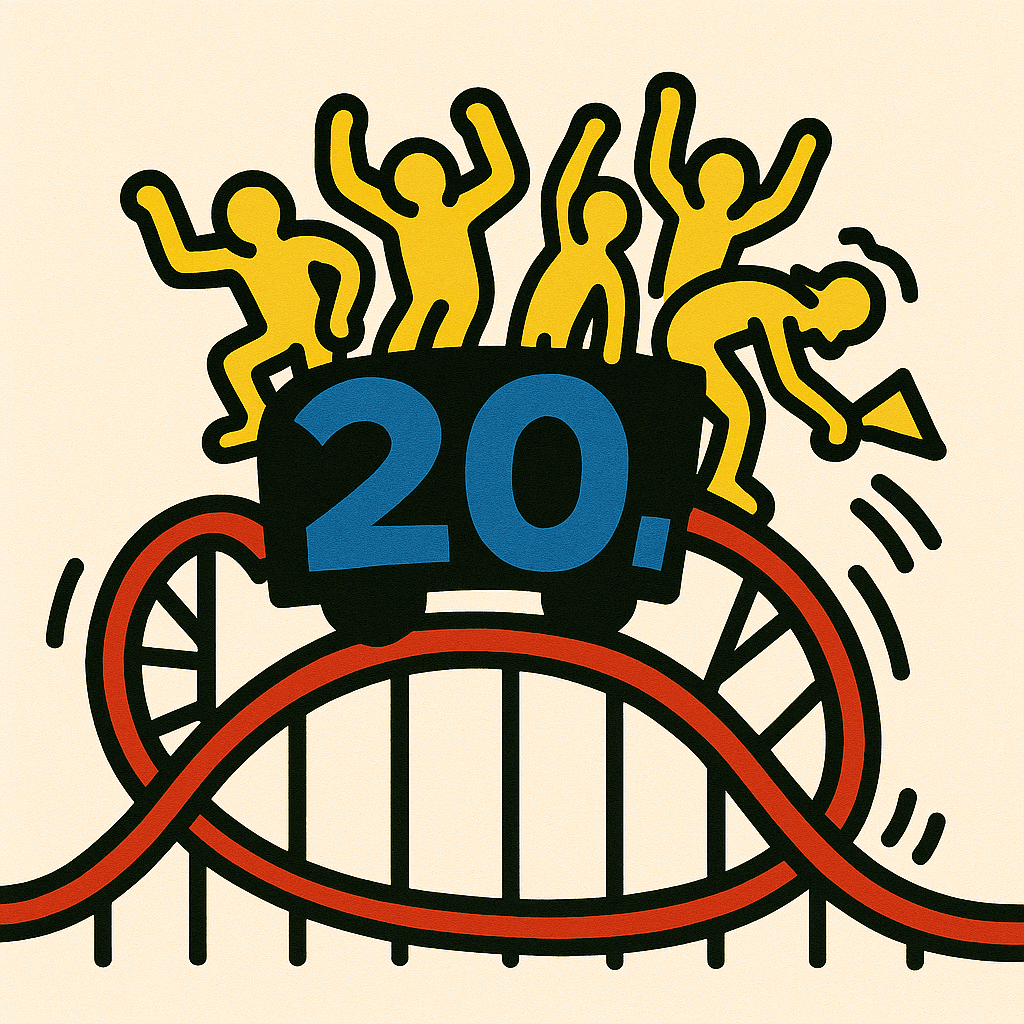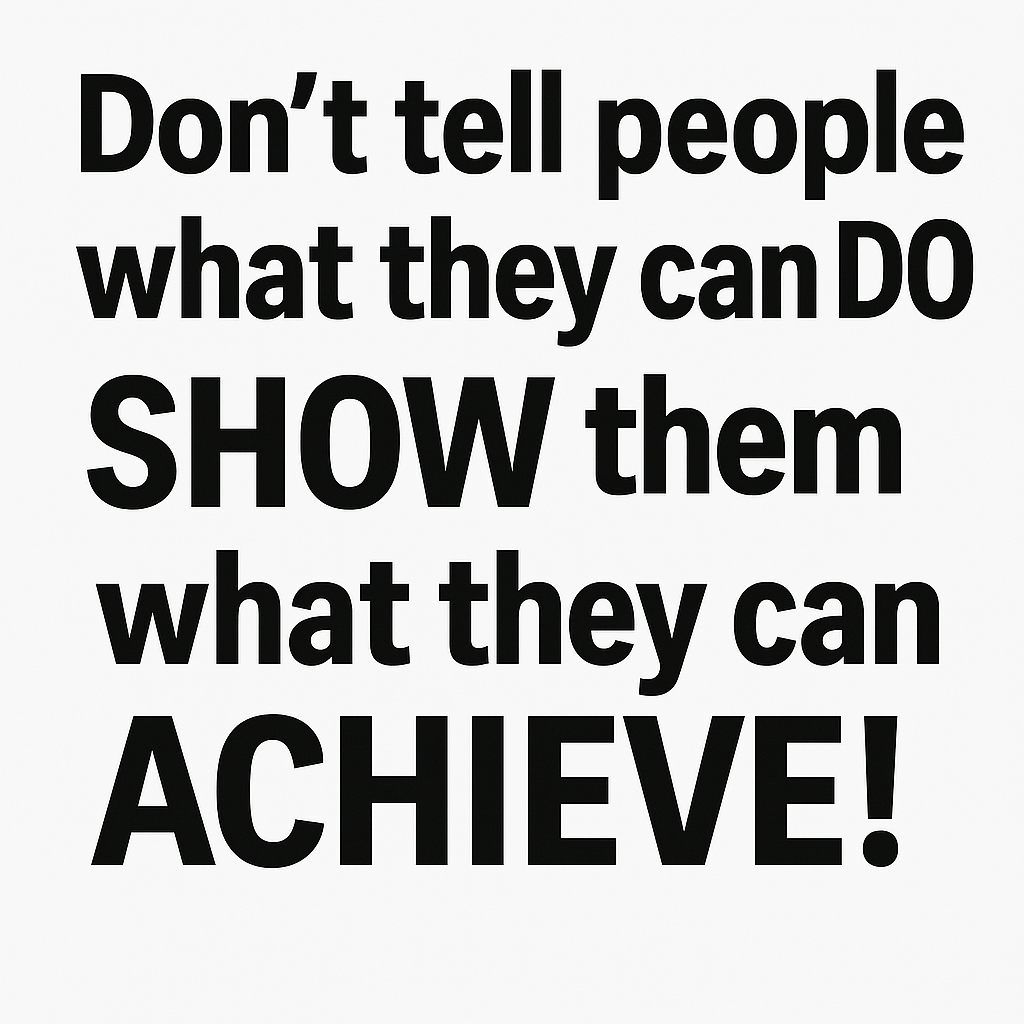Einführung der Metapher: Achterbahn vs. Geisterbahn
Der britische Historiker Ian Kershaw hat das 20. Jahrhundert – genauer gesagt die Geschichte Europas von 1950 bis in die Gegenwart – mit einer Achterbahnfahrt verglichendeutschlandfunk.de. Diese Metapher soll das dramatische Auf und Ab der Entwicklungen verdeutlichen: „Die Achterbahnfahrt erfasst die Wechselhaftigkeit, die atemberaubenden Augenblicke und das Gefühl, von unbeherrschbaren Kräften mitgerissen zu werden“deutschlandfunk.de, so Kershaw. Tatsächlich erlebten die Menschen im 20. Jahrhundert extreme Höhen und Tiefen: Phasen des Fortschritts und Wohlstands folgten auf katastrophale Krisen und vice versa. Allerdings gibt Kershaw zu bedenken, dass eine Achterbahn trotz aller Turbulenzen auf festen Schienen zu einem bekannten Ziel fährtdeutschlandfunk.de – ein Bild, das den realen existenziellen Unsicherheiten der Geschichte nur begrenzt gerecht wird.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welches Bild das junge 21. Jahrhundert angemessen beschreiben könnte. Könnte man die aktuelle Epoche als Geisterbahn charakterisieren? Die Geisterbahn als Jahrmarktattraktion führt ihre Passagiere durch dunkle, unvorhersehbare Tunnel voller Schreckensmomente und gespenstischer Erscheinungen. Übertragen auf unsere Zeit suggeriert die Geisterbahn-Metapher eine Fahrt ins Ungewisse, geprägt von Angst und verunsichernden Überraschungen – als würde die Welt von „Geistern“ heimgesucht, seien es wiederkehrende Gespenster der Vergangenheit oder neue Schreckensvisionen der Zukunft. Im Folgenden wird kritisch untersucht, ob das 21. Jahrhundert aufgrund seiner historischen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen tatsächlich einer Geisterbahn gleicht. Dabei werden Beispiele aus verschiedenen Weltregionen einbezogen – vom Aufstieg autoritärer Regime über die Klimakrise und globale Ungleichheiten bis hin zu technologischen Disruptionen, Konflikten und Demokratiedefiziten.
Historischer Vergleich: 20. vs. 21. Jahrhundert
Das 20. Jahrhundert ging in die Geschichtsbücher ein als Zeitalter der Extreme – mit beispiellosen Zerstörungen, aber auch beispiellosem Fortschritt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte die Welt zwei verheerende Weltkriege, die Millionen Leben forderten, sowie globale Wirtschaftskrisen und totalitäre Regime. Diese Höllenfahrt (Kershaw spricht für 1914–1945 von einem „Höllensturz“deutschlandfunk.de) wurde in der zweiten Jahrhunderthälfte von einer Ära relativer Stabilisierung und Erholung abgelöst: Nach 1945 gab es keine vergleichbaren Flächenbrände mehr in Europa; stattdessen folgten Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, Dekolonisation und der Kalte Krieg. Dennoch blieb die Welt politisch gespalten, und die ständige Angst vor einem Atomkrieg lastete auf der Nachkriegsgenerationdeutschlandfunk.de. Trotz atemberaubenden technischen und materiellen Fortschritts und enormem gesellschaftlichem Wandel blieb das Gefühl der Unsicherheit präsentdeutschlandfunk.de – ganz so, als säßen die Menschen weiter in einer Achterbahn, die jederzeit erneut abstürzen könnte. Erst das Ende des Ost-West-Konflikts um 1990 nährte kurzzeitig die Hoffnung, die „Katastrophen der Vergangenheit“ überwunden zu habendeutschlandfunk.de.
Das frühe 21. Jahrhundert begann zunächst mit Optimismus – man sprach gar vom „Ende der Geschichte“. Doch schnell zeigte sich, dass neue Geister auf der Bühne erschienen. 9/11 markierte 2001 eine Zäsur, die das Sicherheitsgefühl weltweit erschüttertedeutschlandfunk.de. Die Terroranschläge und die folgenden Kriege (Afghanistan, Irak) leiteten ein neues Zeitalter der Unsicherheit ein. Die Versprechen einer friedlicheren, geeinteren Welt wichen neuen Bedrohungsszenarien. In den 2010er-Jahren erlebte der Nahe Osten mit dem sogenannten Islamischen Staat und dem Syrienkrieg grausame Konflikte, deren Auswirkungen – etwa durch Migrationsströme – bis nach Europa und Amerika zu spüren warendeutschlandfunk.de. Hinzu kamen globale Schocks wie die Finanzkrise 2008 und die COVID-19-Pandemie ab 2020, welche die ganze Welt in Mitleidenschaft zogen. Insgesamt wirkt das 21. Jahrhundert bislang weniger wie eine geordnete Achterbahn mit klarer Strecke, sondern eher wie eine unheimliche Geisterbahn: Die Richtung scheint unklar, überall lauern potenzielle Schrecken – von klimatischen Kipppunkten bis zu geopolitischen Eruptionen – und man fragt sich, ob man am Ende sicher herauskommt oder in einem Albtraum steckenbleibt.
Politische Entwicklungen und Herausforderungen
Ein pro-demokratischer Student in Thailand demonstriert 2020 mit dem Symbol des Widerstands – ein Zeichen für den globalen Kampf zwischen Demokratie und Autoritarismus.
Politisch erscheint das 21. Jahrhundert durch eine Rückkehr der Geister der Vergangenheit und neue systemische Herausforderungen geprägt. Während die liberale Demokratie nach 1990 auf dem Vormarsch war, erleben wir seit einigen Jahren einen alarmierenden weltweiten Demokratierückgang. Die Organisation Freedom House verzeichnete 2020 bereits das 15. Jahr in Folge einen Rückgang demokratischer Freiheiten weltweit – ein „langer demokratischer Rezess“, der sich noch vertieftaljazeera.com. Fast drei Viertel der Weltbevölkerung lebten 2020 in Ländern, in denen Rechte und Freiheiten zurückgingen; weniger als 20 % der Menschen leben heute in freien Ländern, so wenige wie seit 1995 nicht mehraljazeera.com. Große Demokratien stehen unter Druck: Indien etwa wurde von „frei“ zu „teilweise frei“ herabgestuft, da die Regierung unter Premier Modi Kritiker unterdrückt und Minderheiten wie Muslime ins Visier nimmtaljazeera.com. In den USA haben politische Polarisierung und Ereignisse wie der Sturm auf das Kapitol 2021 gezeigt, wie fragil selbst etablierte Demokratien sein könnenaljazeera.com. Zugleich erstarken autoritäre Regime und populistische Strongmen rund um den Globus. In Russland etwa konsolidierte Wladimir Putin seit 2000 eine gelenkte Demokratie, die sich in aggressive Außenpolitik entlud – gipfelnd in der Invasion der Ukraine 2022, dem größten Krieg in Europa seit 1945en.wikipedia.org. China entwickelte sich unter Xi Jinping zu einem technologisch hochgerüsteten Überwachungsstaat, der nach innen Dissens unterdrückt (etwa in Xinjiang und Hongkong) und nach außen seinen Einfluss ausdehnt. Auch einige ehemals gefestigte Demokratien zeigen illiberale Tendenzen: So haben in der EU Länder wie Ungarn und Polen durch Einschränkung von Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit Demokratiedefizite offenbart. Türkei unter Erdoğan oder Brasilien unter Bolsonaro (2019–2022) sind weitere Beispiele für den globalen Trend hin zu autoritärerem Führungsstil.
Parallel hierzu mehren sich Konflikte und Krisenherde, die die internationale Ordnung erschüttern. Der Syrienkrieg (seit 2011) verwüstete eine ganze Region und brachte unvorstellbares Leid sowie eine große Flüchtlingswelle mit sich. Im Jemen, in Libyen und in Teilen Afrikas (z.B. Sahelzone, Äthiopien) lodern ebenfalls bewaffnete Konflikte. 2022 ließ Russlands Überfall auf die Ukraine die Schrecken großflächiger Kriege nach Europa zurückkehren. Dieser Konflikt forderte bereits zehntausende Tote, verursacht unvorstellbares Leid der Zivilbevölkerung und führte zur größten Fluchtbewegung innerhalb Europas seit dem Zweiten Weltkriegen.wikipedia.org. Weltweit ist die Zahl der gewaltsamen Auseinandersetzungen so hoch wie lange nicht: 2023 waren 56 bewaffnete Konflikte gleichzeitig im Gange – so viele wie seit 1945 nicht mehrprnewswire.com. Die Zahl der Konflikttoten stieg rasant an und erreichte 2022/23 den zweithöchsten Stand der letzten 30 Jahreprnewswire.com. Über 110 Millionen Menschen sind derzeit durch Krieg und Gewalt auf der Flucht oder vertriebenprnewswire.com – ein erschütternder Rekord. Diese Entwicklungen wecken die Gespenster alter Zeiten: Nationalismus, Großmachtkonfrontation und Krieg sind zurück im globalen Bewusstsein.
Nicht zuletzt wird die globale Politik auch durch neue Bedrohungsformen herausgefordert. Internationaler Terrorismus sorgte in den 2000er-Jahren für diffuse Angst und Sicherheitsmaßnahmen, die Freiheitsrechte beschneiden. Cyberangriffe und Desinformationskampagnen (oft staatlich gelenkt) destabilisieren Demokratien von innen. Technologische Kontrolle – etwa Chinas Social-Credit-System oder der Einsatz von Gesichtserkennung – stellt autoritäre Werkzeuge bereit, um ganze Gesellschaften in Schach zu halten. Die politische Landschaft des 21. Jahrhunderts ist somit gesäumt von Herausforderungen, die wie Spukgestalten auftreten: mal offen brutal, mal schleichend unterwandernd. In einer Geisterbahn der Politik wechseln greifbare Schrecken (wie Bomben und Panzer) mit unsichtbaren, unheimlichen Gefahren (wie dem Aushöhlen demokratischer Institutionen oder der Manipulation durch Fake News) einander ab.
Wirtschaftliche Umbrüche und Verwerfungen
Auch wirtschaftlich gleicht das 21. Jahrhundert bislang einer Fahrt mit ungewissem Ausgang – geprägt von heftigen Einbrüchen, radikalen Umwälzungen und wachsenden Ungleichgewichten. Nach der relativ stabilen Nachkriegsprosperität des späten 20. Jahrhunderts erlebte die Welt ab 2008 die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit vielen Jahrzehnten. Die globale Finanzkrise 2007–08 – ausgelöst durch den Zusammenbruch der Immobilienblase in den USA – riss die Weltwirtschaft in die Tiefe. Im Herbst 2008 stand das internationale Finanzsystem am Abgrund; der damalige Fed-Chef Ben Bernanke bezeichnete jene Wochen als „schlimmste Finanzkrise der Weltgeschichte, einschließlich der Großen Depression“pewresearch.org. In der Tat brach die Wirtschaftsleistung in vielen Ländern dramatisch ein, und die folgende Rezession ging als Great Recession in die Geschichte ein. Die globalen Märkte erholten sich zwar allmählich, doch die Narben blieben: hohe Staatsschulden, mistrauische Bürger und ein Vertrauensverlust in die Versprechen der Globalisierung. In Europa führte die Bankenkrise zu einer Euro-Schuldenkrise (2010–2012), die insbesondere in Ländern wie Griechenland, Spanien oder Italien Massenarbeitslosigkeit und soziale Härten verursachte.
Kaum hatte sich die Weltwirtschaft in den späten 2010ern wieder gefangen, folgte der nächste große Schock: die COVID-19-Pandemie. Die durch das Coronavirus ausgelösten Lockdowns und Unterbrechungen des Wirtschaftslebens im Jahr 2020 ließen die globale Wirtschaft so stark schrumpfen wie seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre nicht mehr. Der IWF sprach vom Great Lockdown und prognostizierte für 2020 ein globales Wachstum von –3 %, was die schlimmste Rezession seit der Großen Depression bedeutete und „weit schlimmer als die globale Finanzkrise“ warimf.org. Binnen weniger Wochen kamen ganze Branchen – vom Tourismus bis zur Industrie – zum Stillstand. Nur mit beispiellosen staatlichen Hilfspaketen konnte ein völliger Kollaps abgewendet werden. Doch die Pandemie machte verwundbare Stellen des Weltwirtschaftssystems sichtbar: globale Lieferketten rissen, viele Länder standen vor Verschuldungskrisen, und 2021/22 schoss die Inflation infolge gestörter Versorgung und geldpolitischer Maßnahmen in die Höhe.
Neben diesen Krisen manifestieren sich tiefgreifende strukturelle Umbrüche. Die fortschreitende Globalisierung hat einerseits das weltweite BIP gesteigert und hunderte Millionen Menschen (vor allem in Asien) aus extremer Armut befreit, andererseits aber auch Verlierer produziert. In vielen westlichen Ländern stagnieren seit der Jahrtausendwende die Realeinkommen der Mittelschicht, während gleichzeitig Produktionsarbeitsplätze ins Ausland verlagert wurden. Dies hat sozialen Sprengstoff für Populismus geliefert. Zugleich erleben wir eine Verschiebung ökonomischer Machtzentren: China stieg im 21. Jahrhundert zur zweitgrößten Volkswirtschaft auf und fordert die ökonomische Dominanz des Westens heraus – ein Wandel, der geopolitische Spannungen befeuert.
Besonders augenfällig ist die Explosion der globalen Ungleichheiten – ein Merkmal, das man als „Gespenst des Raubtierkapitalismus“ bezeichnen könnte. Während das Gesamtvermögen weltweit wuchs, konzentriert es sich immer stärker bei einer schmalen Elite. So haben etwa während der COVID-Krise die Milliardäre ihr Vermögen rapide vermehrt, während der Großteil der Menschheit wirtschaftlich zurückgeworfen wurde. Laut Oxfam verdoppelten die zehn reichsten Männer der Welt ihr Vermögen in den zwei Pandemiejahren, während 99 % der Menschheit Einkommenseinbußen hinnehmen musstenoxfam.org.uk. 2023 besaß das reichste 1 % der Weltbevölkerung beinahe doppelt so viel neues Vermögen wie der gesamte Rest der Welt zusammenoxfam.org.uk. Gleichzeitig stieg die weltweite Armut erstmals seit etwa 25 Jahren wieder anoxfam.org.uk – ein Rückschritt, der vor allem auf die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen zurückzuführen ist. Diese Extreme verdeutlichen eine ökonomische Schieflage, die vielen als unheimlich und ungerecht erscheint: Das Phantom der Ungleichheit spukt in fast allen Gesellschaften, begünstigt soziale Spannungen und stellt die Legitimität des bestehenden Wirtschaftssystems infrage.
Darüber hinaus wirken technologische Disruptionen massiv auf Wirtschaft und Arbeitswelt ein. Die Digitalisierung und Automatisierung – manchmal als vierte industrielle Revolution bezeichnet – haben ganze Branchen umgewälzt. Internetgiganten und Tech-Konzerne dominieren neue Monopolmärkte, während traditionelle Industrien verschwinden. Millionen Arbeitsplätze wurden durch Automatisierung, Robotik und künstliche Intelligenz obsolet oder stark verändert. Zwar entstehen auch neue Jobs, doch die Anpassung führt zu Unsicherheit: Viele Arbeitnehmer fürchten um ihre berufliche Zukunft angesichts von Algorithmen und Maschinen, die Menschen ersetzen könnten. KI-Systeme und Big Data ermöglichen zudem völlig neue Geschäftsmodelle, werfen aber auch schwierige Fragen auf (etwa zum Datenschutz und zur Kontrolle über digitale Monopole). Wirtschaftliche Sicherheit – einst Fundament für gesellschaftlichen Optimismus – ist für viele brüchiger geworden. In der Geisterbahn unserer Zeit gleicht die Ökonomie einer wackligen Plattform, auf der wenige in schwindelerregende Höhen schnellen, während viele andere in die Tiefe zu stürzen drohen.
Gesellschaftliche Spannungen und kulturelle Dynamiken
Die gesellschaftlichen Entwicklungen im 21. Jahrhundert sind von intensiven Spannungen und Umbrüchen geprägt, die oft kulturelle Identitäten und Werte betreffen. Mit der Globalisierung, Migration und dem digitalen Wandel haben sich die sozialen Realitäten rasant verändert – schneller als vielen Menschen lieb ist. Dies hat in vielen Ländern zu einer Polarisierung der Gesellschaft geführt: unterschiedliche Gruppen driften auseinander, Debatten werden emotional und erbittert geführt, und der Konsens über grundlegende Werte scheint zu erodieren.
Ein zentrales Feld ist die Migration und ethnisch-kulturelle Vielfalt. Nie zuvor waren so viele Menschen grenzüberschreitend in Bewegung – sei es aus wirtschaftlichen Gründen, vor Krieg fliehend oder wegen Klimafolgen. Westliche Gesellschaften wurden im Zuge von Einwanderung immer pluralistischer. Das bereichert zwar Kulturen und Arbeitsmärkte, hat aber auch Ängste und Abwehrreflexe ausgelöst. Ein Beispiel war die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, als über eine Million Geflüchtete – vor allem aus Syrien, Irak und Afghanistan – in kurzer Zeit nach Europa kamen. Diese beispiellose Zuwanderung spaltete die öffentliche Meinung: Einer Welle der Solidarität (“Refugees Welcome”) stand ein vehementer Wiederstand aus nationalistischer und fremdenfeindlicher Ecke gegenüber. Populistische Parteien nutzten die Lage aus und schürten Ängste vor Überfremdung – mit durchschlagendem Erfolg. Tatsächlich ging die 2015er-Flüchtlingskrise Hand in Hand mit einem alarmierenden Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte in Europa, die mit Anti-Migrations-Rhetorik massive Stimmengewinne erzieltentime.com. Länder wie Deutschland erlebten den Einzug der AfD ins Parlament, in Italien kam es 2018 zunächst zu einer populistischen Regierung und 2022 übernahm mit Giorgia Meloni erstmals eine post-faschistische Politikerin das Ruder. In vielen europäischen Staaten wurden die gesellschaftlichen Debatten durch das Migrationsthema vergiftet, was Kershaw treffend als „Spannungen des Multikulturalismus“ beschreibtdeutschlandfunk.de. Diese Spannungen – oft manifestiert in Form von Rassismus, Islamophobie oder generell Angst vor dem Anderen – wirken wie ein Gespenst aus dunkleren Zeiten, als Ausgrenzung und Intoleranz offener zutage traten.
Auch kulturelle Wertekonflikte zeichnen unsere Epoche. Fragen von Identität, Religion, Geschlechterrollen und sexueller Orientierung werden öffentlich ausgefochten. Einerseits sind liberale Werte und individuelle Freiheitsrechte auf dem Vormarsch – man denke an die weltweite Ausbreitung der LGBTQ+-Bewegung, an wachsende Sensibilisierung für Gleichberechtigung oder an globale Solidaritätskampagnen via Social Media (#MeToo, Black Lives Matter). Andererseits gibt es starke Gegenbewegungen: Kultureller Traditionalismus und religiöser Fundamentalismus erstarken in verschiedenen Regionen. In den USA etwa sind sogenannte culture wars entbrannt zwischen progressiven und konservativen Lagern über Themen wie Abtreibung, LGBTQ-Rechte, Rassismus-Aufarbeitung und Waffengesetze. In einigen osteuropäischen und afrikanischen Ländern werden LGBTQ-Personen wieder verstärkt diskriminiert oder strafrechtlich verfolgt, was auf einen Rückschritt gegenüber globalen Liberalisierungstrends hindeutet. Soziale Medien wirken dabei wie Brandbeschleuniger für Polarisierung: Sie sorgen zwar für die rasche Verbreitung progressiver Ideen, begünstigen aber ebenso Desinformation und Echokammern, in denen sich extreme Ansichten verhärten. Eine internationale Umfrage in 19 Ländern ergab, dass eine große Mehrheit glaubt, soziale Medien hätten es einfacher gemacht, Menschen mit falschen Informationen zu manipulieren und Gesellschaften zu spaltenpewresearch.orgpewresearch.org. Tatsächlich betrachten 70 % der Menschen die Verbreitung von Fake News im Netz als eine der größten Bedrohungen – gleich nach dem Klimawandelpewresearch.org. Die Wahrheit selbst scheint in der öffentlichen Sphäre umkämpft, was die gesellschaftliche Verständigung fundamental erschwert.
Zudem hat die digitale Lebenswelt neue kulturelle Dynamiken geschaffen. Die junge Generation wächst mit Smartphones, ständiger Vernetzung und Zugang zu schier unendlichen Informationen (und Desinformationen) auf. Dies führt zu einem Wertewandel, der Generationenkonflikte befeuert: Ältere Menschen fühlen sich bisweilen überfordert von der digitalen Geschwindigkeit und beklagen einen Verlust tradierter Normen, während Jüngere die alten Strukturen als überholt ablehnen. Bewegungen wie Fridays for Future, initiiert von Jugendlichen, zeigen die Bereitschaft der Jugend, etablierte Autoritäten herauszufordern – in diesem Fall für den Klimaschutz. Gleichzeitig fühlen sich viele junge Leute unsicher angesichts prekärer Jobs, Wohnungsnot und einer Welt, die von Dauerkrisen geschüttelt wird. Ein Gefühl von Zukunftsangst breitet sich aus.
All diese gesellschaftlichen Spannungen lassen das 21. Jahrhundert in gewisser Weise gespenstisch anmuten. Werte, die lange als selbstverständlich galten, scheinen fragil; gesellschaftlicher Zusammenhalt steht auf dem Prüfstand. Es ist, als ob alte Dämonen – Fremdenhass, Fanatismus, Misogynie – zusammen mit neuen Schattenwesen – etwa den anonymen Hass-Trollen im Internet oder den Verführungen durch Verschwörungstheorien – in der Dunkelheit der Geisterbahn auftauchen, um die Gesellschaft immer wieder zu erschrecken. Doch zugleich gibt es auch Lichtpunkte: Die Zivilgesellschaft ist vielerorts wach und aktiv, es gibt Solidarität über Grenzen hinweg (etwa in globalen Protestbewegungen), und aus Konflikten entstehen oft neue kulturelle Ausdrucksformen und Dialoge. Die Geisterbahn-Fahrt der Gesellschaft ist chaotisch, aber sie ist auch von menschlicher Resilienz und Kreativität begleitet.
Globale Krisen: Klimakrise, Migration, Pandemien, KI
Neben Politik, Wirtschaft und Kultur offenbaren sich im 21. Jahrhundert insbesondere globale Krisen, die wie unheilvolle Geister über der Menschheit schweben. Einige dieser Herausforderungen – allen voran der Klimawandel – haben das Potenzial, die Grundlagen der Zivilisation zu erschüttern, wenn nicht gar apokalyptische Züge anzunehmen. Andere, wie Pandemien oder disruptive Technologien, tauchen plötzlich aus dem Dunkeln auf und verbreiten Schrecken. Charakteristisch ist, dass all diese Probleme transnational sind: Kein Land kann ihnen allein entkommen, was das Gefühl der Ausgeliefertheit verstärkt.
Die Klimakrise gilt weithin als vielleicht größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Wissenschaftler und Sicherheitsexperten warnen unisono, dass die Erderwärmung eine fundamentale Bedrohung für die menschliche Sicherheit und die Stabilität aller Staaten darstelltadelphi.de. Bereits jetzt erfahren wir extreme Wetterereignisse mit beispielloser Wucht: verheerende Hitzewellen, Dürreperioden, Waldbrände von Australien bis Kalifornien, Überflutungen und Superstürme. Der Juli 2023 war der heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen, und die letzten Jahre brachen immer wieder Temperaturrekorde – klare Anzeichen dafür, dass wir uns gefährlich nah an Kipppunkten bewegen. Die Klimakrise wirkt wie ein drohender Schatten: sie schreitet schleichend voran, aber ihre Auswirkungen sind zunehmend spürbar und unheimlich. Besonders perfide ist, dass sie bestehende Ungleichheiten verstärkt – verwundbare Regionen (etwa Inselstaaten, Sahelzone) leiden am frühesten und stärksten, obwohl sie am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben. Schon bezeichnet man den Klimawandel als „größte Bedrohung für die globale Gesundheit“ und Sicherheit in diesem Jahrhundertklimawandel-gesundheit.deadelphi.de. Die internationale Gemeinschaft hat zwar Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen geschlossen, doch die Emissionen steigen weiterhin, und die notwendige Transformation (Dekarbonisierung) kommt quälend langsam voran. Das Szenario eines außer Kontrolle geratenen Klimas – mit unbewohnbaren Zonen, Massenmigration und Ressourcenkonflikten – gleicht einem Geisterbahn-Horrorvision, die hoffentlich nie Realität wird. Dennoch: Jedes neue IPCC-Alarmgutachten wirkt wie ein unheilverkündender Spuk, der die Menschheit zum Handeln mahnt, bevor es zu spät ist.
Eine weitere globale Krise ist die bereits erwähnte Migration. Zwar ist Migration an sich ein normales historisches Phänomen, doch durch Kriege, Staatszerfall und Klimaschäden erreicht die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen neue Rekordstände. Über 110 Millionen Menschen sind aktuell auf der Fluchtprnewswire.com – viele von ihnen über Kontinente hinweg. Das 21. Jahrhundert sah bereits große Fluchtbewegungen: etwa aus Syrien, dem Irak und Afghanistan Richtung Europa in den 2010ern oder aus Venezuela in die Nachbarstaaten, jüngst die Flucht von Millionen Ukrainern vor dem Krieg. Darüber hinaus gibt es Millionen Arbeitsmigranten, die instabilen Staaten entkommen wollen, sowie künftig wohl mehr und mehr Klimaflüchtlinge, die ihre Heimat wegen Unbewohnbarkeit verlassen müssen. Diese Migrationsströme stellen die Aufnahmeländer vor humanitäre und logistische Herausforderungen und entfachen innenpolitisch oft heftige Kontroversen (siehe Abschnitt oben). Gleichzeitig leiden die Herkunftsländer unter Brain-Drain und dem Verlust ganzer Generationen. Die globale Migrationskrise ist damit ein weiterer Geist, der Unruhe und Angst erzeugt – oft befeuert durch populistische Darstellungen eines „Migrantenansturms“. Ohne faire und koordinierte Lösungen droht hier eine Dauerkrise mit hohem Konfliktpotenzial, insbesondere wenn Klimawandel und Konflikte weitere Millionen Menschen zur Flucht zwingen.
Die Pandemien haben uns im jungen 21. Jahrhundert schmerzhaft vor Augen geführt, wie verletzlich unsere globalisierte Welt ist. Die COVID-19-Pandemie (2020–2022) versetzte den gesamten Planeten in einen Ausnahmezustand, wie es ihn seit der Spanischen Grippe 1918 nicht gegeben hatte. Ein unsichtbares Virus aus dem Nichts verbreitete sich rasend schnell über alle Grenzen hinweg. Über sechs Millionen Menschen sind bislang offiziell an oder mit Covid-19 gestorbenrnd.de (Schätzungen gehen von weit mehr – bis zu 15–20 Millionen – Toten ausrnd.de). Die Pandemie legte Wirtschaft und öffentliches Leben zeitweise lahm, füllte Intensivstationen und ließ die Menschen in Angst um ihre Gesundheit und Existenz zurück. Besonders gespenstisch war die Ungewissheit am Anfang: Bilder von überforderten Krankenhäusern in Bergamo, von Massengräbern in Lateinamerika oder stillgelegten Metropolen wie New York wirkten apokalyptisch. Erst beispiellose Wissenschaftskooperationen führten zu Impfstoffen, welche die Lage nach und nach entschärften. Doch COVID-19 lehrte uns Demut: Neue Krankheitserreger – ob zoonotisch übertragen wie dieses Coronavirus oder gar Laborunfälle – können jederzeit auftauchen. Auch alte Bekannte wie Ebola kehren wieder. In einer hypervernetzten Welt kann aus einem lokalen Ausbruch binnen Wochen eine globale Pandemie werden. Die Erfahrung wirkt wie eine Geisterbahnfahrt durch einen Spiegelsaal der Biologie: Wir sehen, wie rasch unsere zivilisatorische Fassade bröckeln kann, wenn die Natur zurückschlägt. Pandemien sind zu einem ständigen Damoklesschwert geworden, das besseres Vorsorgemanagement, internationale Zusammenarbeit und Resilienzplanung erzwingt.
Schließlich ist da die technologische Disruption durch Künstliche Intelligenz (KI) – ein Phänomen, das sich zwar nicht als klassische „Krise“ manifestiert, aber bei vielen Zukunftsbeobachtern echte Existenzängste schürt. KI-gestützte Systeme haben in den letzten Jahren enorme Sprünge gemacht: Von selbstfahrenden Autos über Algorithmen, die menschliche Profis im Schach oder Go besiegen, bis hin zu Sprach-KIs wie ChatGPT, die menschenähnliche Texte generieren können. Diese Entwicklung birgt riesige Chancen – von Effizienzgewinnen bis zu neuen Lösungen in Medizin und Klimamanagement – aber auch gravierende Risiken. So warnt z.B. das World Economic Forum, dass bis 2025 Automatisierung und KI weltweit Millionen Jobs verdrängen könnten, was ganze Berufsfelder obsolet macht. Zudem können KI-Systeme bereits jetzt Desinformation in großem Stil erzeugen (Stichwort Deepfakes), was die Gefahr von Manipulation weiter erhöht. In autoritären Händen könnten intelligente Überwachungssysteme individuelle Freiheiten aushöhlen („KI kann uns entmündigen, mit falschen Informationen füttern und uns den Job streitig machen“deutschlandfunk.de). Und am Horizont zeichnet sich sogar eine noch düstere Debatte ab: Was, wenn eines Tages eine Superintelligenz entsteht, die wir nicht mehr kontrollieren können? 2023 veröffentlichten hunderte KI-Experten – darunter die führenden Köpfe großer Tech-Konzerne – ein öffentliches Statement, wonach die Eindämmung des Risikos eines KI-bedingten menschlichen Aussterbens höchste Priorität haben sollte, vergleichbar mit der Verhütung eines Atomkriegs oder globaler Pandemienki-folgen.de. Selbst wenn dieses Szenario extrem erscheint, verdeutlicht es doch die ernste Sorge, dass wir eine Technologie entfesseln, die sich verselbständigt. KI ist somit ein weiterer Geist in der Bahn – faszinierend und furchteinflößend zugleich. Die Menschheit steht vor der Aufgabe, diesen Geist zu zähmen, bevor er außer Kontrolle gerät.
Insgesamt zeichnen sich die globalen Krisen des 21. Jahrhunderts durch ihre enge Verflechtung aus. Klimastress kann Konflikte und Migration auslösen; Pandemien können wirtschaftliche und politische Krisen verschärfen; technologische Umwälzungen beeinflussen alle genannten Bereiche. Dieses Krisenknäuel verstärkt das Empfinden einer chaotischen, unberechenbaren Fahrt. Anders als im 20. Jahrhundert, wo die Hauptbedrohungen oft klar auszumachen waren (z.B. ein Aggressorstaat, eine Ideologie oder eine Wirtschaftskrise zu einer Zeit), erlebt das 21. Jahrhundert Multiple Krisen parallel. Das trägt zum Gefühl einer permanenten Alarmbereitschaft bei – als befände man sich fortwährend in der Dunkelkammer der Geisterbahn, wo hinter jeder Ecke das nächste Schreckgespenst lauert.
Fazit: Ist das 21. Jahrhundert eine Geisterbahn?

Ist es also gerechtfertigt, das 21. Jahrhundert als Geisterbahn zu bezeichnen? Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass unsere Epoche in vielen Dimensionen durch Unvorhersehbarkeit, Angst und latente Bedrohungen charakterisiert ist. Im Vergleich zur Achterbahnfahrt des 20. Jahrhunderts, die heftige Aufs und Abs kannte, erscheint das 21. Jahrhundert weniger als geregelter Wechsel zwischen Höhen und Tiefen, sondern eher als anhaltende Zitterpartie mit ungewissem Ausgang. Mehrere Aspekte untermauern die Geisterbahn-Metapher:
- Unbekannte Strecke: Während historische Ereignisse im Rückblick einer gewissen Logik folgen, haben wir heute oft das Gefühl, im Dunkeln zu tappen. Die Zukunftsgewissheiten früherer Generationen (Glaube an stetigen Fortschritt, an dauerhaften Frieden nach 1945, an stabile Demokratien) sind erschüttert. Niemand kann verlässlich sagen, wohin die Reise des 21. Jahrhunderts geht – ob wir am Ende vielleicht in einer besseren Welt ankommen oder durch Fehlentscheidungen ins Desaster steuern.
- Angst und Verunsicherung: Die Vielzahl gleichzeitiger Krisen – von Klimawandel über politische Extreme bis zur digitalen Revolution – erzeugt in den Gesellschaften ein Grundgefühl der Unsicherheit, vergleichbar mit der Nervosität in einer Geisterbahn. Viele Menschen haben das subjektive Empfinden, dass früher „alles sicherer/simpler“ war, und fühlen sich von den aktuellen Veränderungen überfordert. Das Vertrauen in Institutionen hat gelitten, Verschwörungstheorien boomen. Die Angst ist zu einem beherrschenden Faktor geworden – Angst vor sozialem Abstieg, vor Umweltkatastrophen, vor Fremden, vor Kontrollverlust an Maschinen, etc. Diese Mentalitätslage passt ins Bild einer Geisterbahnfahrt, wo Furcht allgegenwärtig ist.
- Wiederkehr der Geister der Vergangenheit: Erschreckend viele Entwicklungen erinnern an dunkle Kapitel des 20. Jahrhunderts – seien es Kriege in Europa, Völkermorddrohungen (z.B. durch IS), Konzentrationslager-ähnliche Internierungen (z.B. der Uiguren in China), aufkeimender Faschismus oder autoritäre Herrschaft. Geschichte wiederholt sich zwar nie exakt, aber gewisse „Gespenster“ feiern ein Comeback. Das 21. Jahrhundert wird von diesen Untoten der Geschichte heimgesucht, was das Gefühl vermittelt, nichts sei wirklich überwunden.
- Neue Schreckensszenarien: Gleichzeitig bringt das 21. Jahrhundert gänzlich neuartige potenzielle Schrecken hervor, die vorher eher Science-Fiction waren: ein unbewohnbares Erdklima, globale Virus-Seuchen in Echtzeit, KI-Systeme, die ihre Schöpfer überflügeln. Diese unbekannten Horrors sorgen für eine zusätzliche Dimension der Unsicherheit. In der Achterbahn-Metapher gab es zumindest die Annahme fester Schienen – nun scheint sogar das nicht mehr sicher, da wir Neuland betreten.
Dennoch sollte man die Geisterbahn-Metapher nicht als rein pessimistische Kapitulation vor dem Chaos verstehen. Jede Metapher hat Grenzen. Kershaw selbst fragte kritisch, ob die Vergnügungspark-Assoziation einer Achterbahn den „existenziellen Krisen“ überhaupt gerecht werdedeutschlandfunk.de. Ähnlich könnte man fragen: Ist das 21. Jahrhundert wirklich nur Schrecken und Illusion? Gibt es nicht auch Lichtblicke und Lernmomente auf dieser Fahrt? Tatsächlich hat die Menschheit in den letzten zwei Jahrzehnten enorm viel dazugelernt und auch Erfolge errungen: extreme Armut wurde bis 2020 deutlich reduziert, medizinische Fortschritte (z.B. mRNA-Impfstoffe gegen Covid) wurden in Rekordzeit erzielt, die Digitalisierung eröffnet Bildungs- und Vernetzungsmöglichkeiten, die zuvor unvorstellbar waren. Global agieren heute viel mehr Akteure als früher für eine bessere Welt – von NGOs über Jugendbewegungen bis zu engagierten Städten und Unternehmen. Und man darf nicht vergessen: Eine Geisterbahn mag Angst machen, aber man kann sie auch heil überstehen, wenn man die Nerven behält und die richtigen Weichen stellt.
In Summe überwiegt jedoch das Gefühl, dass das 21. Jahrhundert bislang kein behaglicher, linearer Weg war, sondern eine holprige Fahrt in ständiger Anspannung. Ja, vieles deutet darauf hin, dass wir uns in einer Geisterbahn der Geschichte befinden. Die Kunst besteht nun darin, diese Fahrt so zu steuern, dass aus dem Gruseltrip kein echter Untergang wird.
Ausblick auf mögliche Zukunftsszenarien
Wenn wir aus der Geisterbahn-Metapher Schlüsse ziehen, ergeben sich verschiedene Zukunftsszenarien – von dystopisch bis hoffnungsvoll. Diese sollen abschließend skizziert werden:
- Das Dystopie-Szenario: In diesem pessimistischen Bild beschleunigt sich die Geisterbahnfahrt unkontrolliert weiter. Die Klimakrise gerät außer Kontrolle und führt bereits Mitte des Jahrhunderts zu ständigen Katastrophen und Verteilungskämpfen um Ressourcen. Autoritäre Regime gewinnen die Oberhand, Demokratien zerfallen oder werden ausgehöhlt; vielleicht kommt es gar zu einem großen Krieg zwischen Großmächten um Vorherrschaft. Soziale Ungleichheit spitzt sich zu, sodass Unruhen und Gewalt im Innern zunehmen. Technologisch könnten Fehlentwicklungen – etwa eine schädliche Super-KI oder biologische Fehler – globale Schäden anrichten. Kurz: Die Menschheit würde von den „Geistern“ überwältigt, die sie rief oder ignorierte. Dieses Szenario wäre geprägt von Dauerkrisen, Angstherrschaft und dem möglichen Kollaps unserer vernetzten Zivilisation.
- Das Bewältigungs-Szenario: Hier gelingt es der Menschheit, die Geister nach und nach zu bändigen. Die kommenden Jahrzehnte bringen eine Art Wende, wo aus Erkenntnis und Druck heraus große Veränderungen eingeleitet werden. Beispielsweise könnte eine massive globale Klimapolitik mit grüner Technologie den Temperaturanstieg noch begrenzen und langfristig stabilisieren. Demokratien könnten sich durch Reformen und Regulierung (etwa der Tech-Konzerne) erneuern und resilienter gegen Autoritarismus werden. Möglicherweise führt die Kooperation in Krisen (wie bei künftigen Pandemien oder beim Wiederaufbau nach Klimaschäden) zu einer Stärkung internationaler Solidarität – einer Renaissance von Multilateralismus und Vereinten Nationen, ähnlich wie nach 1945. Sozial könnten Bildungsinitiativen und progressive Politik den Extremismus zurückdrängen. Technologie würde verantwortungsvoll eingesetzt: KI als Werkzeug zum Wohle aller, mit globalen Regeln, die Missbrauch verhindern. In diesem Szenario verwandelt sich die anfangs unheimliche Fahrt in eine zielgerichtete Reise – man schafft es, Licht in die Geisterbahn zu bringen und die Schienen neu zu verlegen, sodass ein gutes Ende möglich ist.
- Das Stagnations-Szenario: Vorstellbar ist auch eine Zukunft ohne klare Auflösung – die Geisterbahn fährt weiter, mal rauf, mal runter, aber ohne finalen Crash oder finale Erlösung. Krisen werden hier gemanagt, aber nicht wirklich gelöst. Die Welt arrangiert sich mit einem mittleren Temperaturanstieg, mit chronischen Konflikten auf kleiner Flamme, mit wechselhaften Regierungsformen und fortbestehender Ungleichheit. Es kommt nicht zum Schlimmsten (keine totale Klimakatastrophe, kein Weltkrieg, keine KI-Übernahme), aber die großen Aufgaben bleiben Stückwerk. Dieses Szenario wäre weniger dramatisch, aber dennoch unbefriedigend: Ein ständiges Durchwursteln, ein Leben mit den Geistern als dauerhafte Mitfahrer sozusagen. Einige Regionen könnten prosperieren, andere verfallen; die globale Kluft bliebe groß.
Welches dieser Szenarien eintritt – oder welche Mischform – hängt maßgeblich von den Entscheidungen ab, die wir heute treffen. Das 21. Jahrhundert ist noch jung; die Weichen lassen sich noch stellen. Kershaw empfahl im europäischen Kontext, der „Konvoi“ solle zusammenbleiben und nicht auseinanderdriften, um in gefährlichen Gewässern zu bestehendeutschlandfunk.de. Übertragen auf die Weltgemeinschaft heißt das: Kooperation ist der Schlüssel. Wenn die Staaten und Gesellschaften es schaffen, gemeinschaftlich gegen die globalen Geister vorzugehen – seien es CO₂-Emissionen, Pandemien oder Cybergefahren – besteht die Chance, dass die Fahrt am Ende doch in ruhigere Bahnen einmündet.
Abschließend lässt sich sagen: Die Metapher der Geisterbahn für das 21. Jahrhundert ist kritisch-analytisch durchaus treffend, da sie unser momentanes Empfinden einer gleichzeitig erschreckenden und ungewissen historischen Fahrt spiegelt. Doch sie sollte uns nicht zur Resignation verleiten. Jede Bahn hat einen Ausgang. Es liegt an uns, ob wir am Ende des Jahrhunderts erschöpft und verängstigt aus den Waggons taumeln – oder ob wir den Mut und die Klugheit finden, die Geister zu besiegen und ins Freie zu gelangen. In der Geisterbahn der Gegenwart ist Aufklärung, Zusammenarbeit und humanistischer Wertekompass der Lichtstrahl, mit dem wir die Dunkelheit durchdringen können.
Quellen: Die Analyse stützt sich auf verschiedene aktuelle Quellen und Beispiele. Historische Einordnung und die Achterbahn-Metapher sind aus Ian Kershaws Werken entnommendeutschlandfunk.dedeutschlandfunk.de. Daten zum Demokratieabbau stammen u.a. von Freedom Housealjazeera.comaljazeera.com, während Konfliktstatistiken dem Global Peace Index 2023 entnommen sindprnewswire.comprnewswire.com. Wirtschaftliche Fakten zur Finanzkrise und Pandemie sind durch Berichte der Fed und des IWF belegtpewresearch.orgimf.org. Zahlen zur Ungleichheit und Armut basieren auf Oxfam-Analysenoxfam.org.uk. Die gesellschaftlichen Entwicklungen wurden unter Bezug auf Umfragen (z.B. Pew Research zu sozialen Medien)pewresearch.orgpewresearch.org sowie Berichten über Europas Rechtsrucktime.com diskutiert. Zur Klimakrise und globalen Risiken dienen Aussagen von Experten als Grundlageadelphi.de, und die Warnungen führender KI-Forscher über existenzielle KI-Gefahren sind dokumentiertki-folgen.de. Diese und weitere Quellen untermauern das hier gezeichnete Bild. Letztlich bleibt festzuhalten: Ob die Geschichtsschreibung das 21. Jahrhundert als finstere Geisterbahn oder als erfolgreicher Balanceakt betrachtet, hängt davon ab, welche Lehren wir ziehen – die Weichen sind gestellt, doch die Fahrt ist im vollen Gange. deutschlandfunk.deki-folgen.de
Cui bono? Profiteure von Krisen im 20. und 21. Jahrhundert – eine kritische Analyse
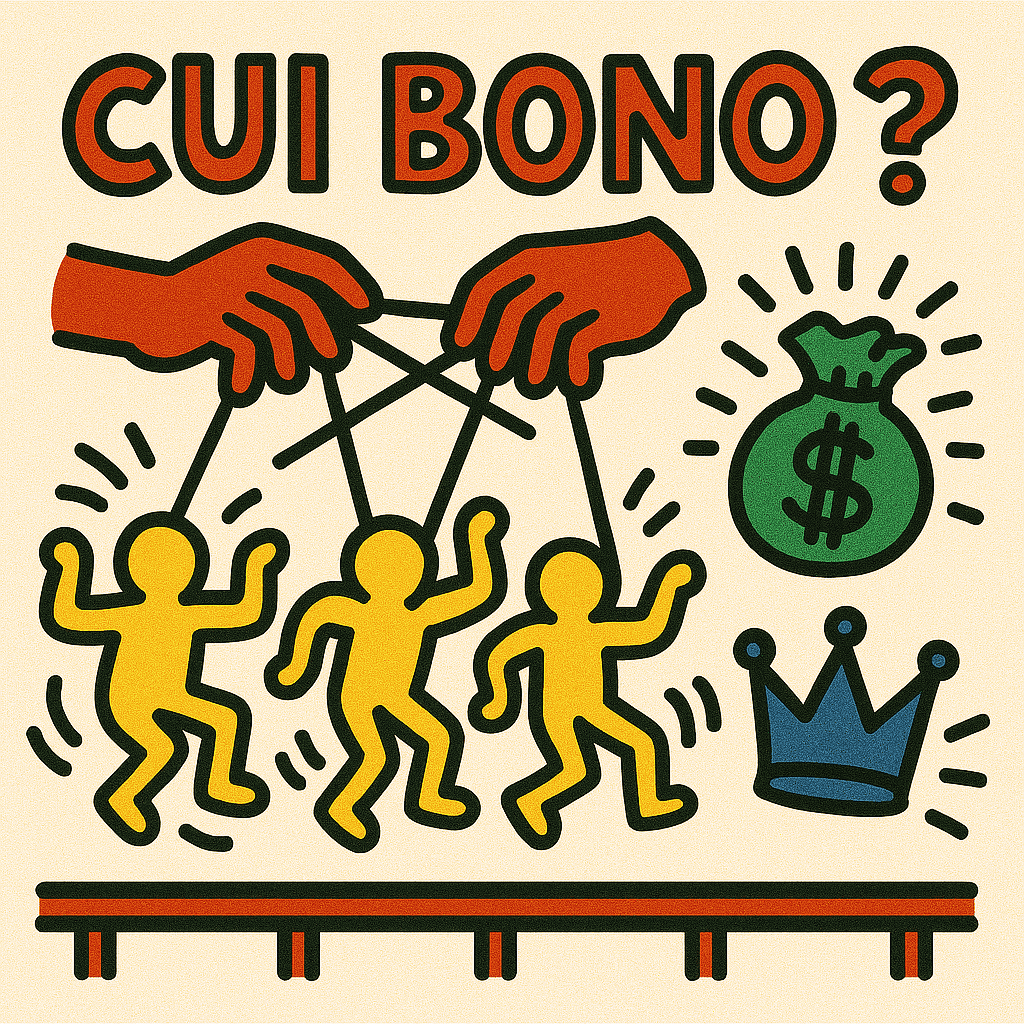
Einleitung: Die lateinische Frage „Cui bono?“ – „Wem zum Vorteil?“ oder „Wer profitiert?“ – dient seit der Antike als Werkzeug der Aufklärung und Kritik. Gerade in den turbulenten Entwicklungen des 20. Jahrhunderts (einer politischen Achterbahn mit Weltkriegen, Systemumbrüchen und ideologischen Konfrontationen) und des 21. Jahrhunderts (einer Geisterbahn voller neuer globaler Krisen von Terror bis Pandemie) stellt sich diese Frage mit Nachdruck. In Krisenzeiten leiden meist breite Bevölkerungsgruppen – doch bestimmte Akteure ziehen aus Unsicherheit und Umbruch Nutzen. Diese Analyse beleuchtet differenziert, wer in vergangenen und aktuellen Krisen profitierte, welche Interessen hinter Konflikten und Katastrophen stehen und wie Einfluss und Gewinn in Krisenzeiten gesichert oder ausgebaut werden. Dabei werden Beispiele von den Weltkriegen über den Kalten Krieg bis hin zu Terrorismus, Klimakrise, Pandemie, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI) einbezogen. Ein abschließendes Fazit zieht kritisch Bilanz.
Profiteure von Krisen, Umbrüchen und Unsicherheiten
Krisen – seien es Kriege, wirtschaftliche Zusammenbrüche oder globale Notlagen – schaffen stets Gewinner und Verlierer. Zu den historischen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Profiteuren solcher Umbrüche zählen häufig:
- Staaten und Machtblöcke: Ganze Staaten oder Führungsmächte können gestärkt aus Krisen hervorgehen. So festigten etwa die USA und die UdSSR ihre geopolitische Stellung als Supermächte nach dem Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg. Siegerstaaten erhalten territoriale Gewinne, Zugang zu Ressourcen oder neuen Einfluss auf die Weltordnung. Beispielsweise nutzten die westlichen Alliierten nach 1945 ihre Vormacht, um Institutionen wie die UNO, Weltbank und das Bretton-Woods-System zu etablieren – Strukturen, die ihren Interessen dienten. Auch kleinere Staaten können Krisen nutzen: Der „Krieg gegen den Terror“ nach 2001 legitimierte weltweit den Ausbau sicherheitsstaatlicher Kompetenzen. Autoritäre Regime stabilisieren ihre Macht nicht selten, indem sie interne oder externe Krisen ausrufen und so Zusammenhalt erzwingen.
- Konzerne und ökonomische Eliten: Wirtschaftliche Großakteure – von Rüstungskonzernen über Rohstoff- und Energieunternehmen bis hin zu Technologie- und Pharmafirmen – zählen oft zu den klaren Gewinnern von Krisen. Historisch prosperierte insbesondere die Rüstungsindustrie im Krieg: Ihre Profite waren im Ersten Weltkrieg „verhältnismäßig 3–4 mal höher als bei Zivilindustrien gleicher technischer Leistungen“de.wikipedia.org. Dieses Geschäftsmodell des Krieges ist bis heute ein „globales Problem“, denn Waffenhersteller und -händler erzielen enorme Renditen in Konfliktende.wikipedia.org. Ähnlich profitierten auch zivile Unternehmen, die in Kriegszeiten staatliche Aufträge für Versorgung, Wiederaufbau oder Besatzungsverwaltung erhielten – oft Firmen aus den Ländern auf der Siegerseitede.wikipedia.org. Im 21. Jahrhundert setzt sich dieser Trend fort: Rüstungs- und Sicherheitskonzerne erhielten infolge des 11. September 2001 und der folgenden Kriege massive Regierungsaufträge. Die US-Militärausgaben stiegen nach 2001 drastisch – insgesamt wurden seit Beginn des Afghanistan-Kriegs über 14 Billionen US-Dollar vom Pentagon ausgegeben, wovon bis zur Hälfte direkt an private Rüstungs- und Militärdienstleister flosswatson.brown.edu. Große Rüstungskonzerne, private Söldnerfirmen und Logistikanbieter (z. B. Halliburton/KBR im Irak) konnten Milliardengewinne verbuchen. So erhielt die Halliburton-Tochter KBR 2003 einen einzigen Auftrag im Umfang von 7 Milliarden US-Dollar zur Öl-Infrastruktur im Irak – ohne Ausschreibung und mit politischer Rückendeckungcbsnews.com. Auch außerhalb des Militärs gibt es Krisengewinner: Energiekonzerne nutzten z. B. den Ölpreisschock während Kriegen, um Profite zu steigern. Technologie- und Internetunternehmen wiederum gewannen an Marktmacht durch die Digitalisierungsschübe in unsicheren Zeiten; insbesondere während der COVID-19-Pandemie explodierten die Börsenwerte von Tech-Konzernen (E-Commerce, Videokonferenzen, soziale Netzwerke), da ihr Nutzen in der Krise sprunghaft anstieg. Pharma- und Medizinunternehmen erzielten enorme Umsätze durch dringend benötigte Medikamente, Schutzausrüstung oder Impfstoffe. Insgesamt hat die Corona-Krise die extreme Vermögenskonzentration weiter verschärft: Während die Weltwirtschaft einbrach, steigerten die 2.700 Milliardäre weltweit ihr Vermögen im Pandemiejahr 2020 um ca. 60 % (rund 5 Billionen $)diw.de – ein sprunghafter Zuwachs, der das Jahr 2020 für diese Ultra-Reichen zum erfolgreichsten Finanzjahr der Geschichte machtediw.de. Zugleich stürzten über 100 Millionen Menschen zusätzlich in bittere Armutdiw.de. Diese krasse Diskrepanz verdeutlicht, dass globale Krisen für eine kleine wohlhabende Elite zu „extrem guten Geschäften“ werden könnendiw.de.
- Politische und gesellschaftliche Eliten: Krisen können auch politischen Führungsfiguren und herrschenden Eliten nutzen. Innenpolitisch bieten Notlagen oft Gelegenheit, Macht zu konsolidieren oder unbequeme Opposition auszuschalten. So wurde etwa Adolf Hitlers Position durch die selbst geschaffene „Reichstagsbrandkrise“ 1933 gestärkt – er erhielt per Notverordnung diktatorische Vollmachten. Ähnliche Mechanismen sind in modernen Demokratien subtiler, aber vorhanden: Regierungen können in einem Klima der Angst schwierige Entscheidungen durchsetzen, das Volk hinter sich scharen („ rally round the flag “-Effekt) und Bürgerrechte temporär einschränken. Beispielsweise steigerte die Bush-Administration nach 9/11 ihren Handlungsspielraum enorm (Patriot Act, Heimatschutzministerium etc.), was ihre politische Agenda erleichterte. International können Eliten Krisen nutzen, um Agenda Setting zu betreiben oder von eigenem Versagen abzulenken. Gesellschaftlich profitieren oft jene, die bereits privilegiert sind: Vermögende Familien und Großanleger können Krisen nutzen, um günstig Vermögenswerte zu erwerben oder Marktanteile zu erhöhen, während kleine Akteure scheitern. In autoritären Systemen stärken Krisen die herrschende Klasse (Militärjunta, Partei oder Dynastie), indem sie den Ausnahmezustand perpetuiert und Loyalität erzwingt.
- Lobbygruppen und transnationale Netzwerke: “Wem nützt es?” lässt sich auch auf organisierte Interessen anwenden. Lobbyverbände bestimmter Branchen nutzen Krisen, um Politiker zu beeinflussen und für ihre Anliegen schnelle Lösungen zu fordern. Ein Beispiel ist die Finanzindustrie, der es nach dem Crash 2008 gelang, milliardenschwere Rettungspakete mitzugestalten – viele Banken “too big to fail” erhielten Steuergelder, die letztlich ihren Anteilseignern zugutekamen, während die Allgemeinheit die Kosten trug. Internationale Organisationen spielen in Krisen teils eine ambivalente Rolle: Institutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) oder die Weltbank greifen in Schulden- oder Währungskrisen ein, offiziell um Stabilität zu sichern. Kritiker bemerken jedoch, dass deren Strukturanpassungsprogramme und Kreditauflagen häufig westlichen Konzernen neue Märkte öffneten (Privatisierungen, Freihandel) – die lokalen Bevölkerungen hingegen litten unter harten Sparauflagen. Auch Public-Private-Partnerships (PPP) auf globaler Ebene – etwa zwischen staatlichen Stellen, NGOs und Unternehmen – können in Krisen die Einflussmöglichkeiten großer Konzerne erhöhen (z. B. in der globalen Gesundheitsvorsorge oder Klimapolitik).
Zusammengefasst zeigen Krisen immer wieder ein ähnliches Bild: Staatliche Akteure, Großunternehmen, finanzielle und politische Eliten sowie ihre Interessenverbände vermögen Notsituationen in überproportionale Vorteile umzumünzen – seien es Gewinne, Machtzuwachs oder strategische Positionierung. Dies führt direkt zur Frage nach den tieferen Interessenstrukturen hinter Krisen.
Strukturelle Interessen als Treiber und Verstärker von Krisen
Hinter vielen historischen und aktuellen Krisen stehen strukturelle Interessen, die Konflikte auslösen oder verschärfen. Krisen fallen nicht vom Himmel – oft wirken latente Ziele und Begehrlichkeiten mächtiger Akteure im Hintergrund. Zu den wichtigsten strukturellen Interessen zählen:
- Machtstreben und geopolitischer Einfluss: Der Wille, Macht zu erringen oder zu erhalten, ist ein zentraler Motor vieler Krisen. Herrschende Regime können bewusst Spannungen schüren, um innenpolitisch die Machtbasis zu sichern (z. B. durch das Schüren von Feindbildern). Außenpolitisch führen Großmächte Konflikte, um Einflusssphären auszudehnen oder Rivalen zu schwächen. Der Kalte Krieg etwa war nicht nur ideologisch motiviert, sondern wurde von beiden Supermächten als Nullsummenspiel um globale Vorherrschaft gesehen. Regionale Kriege und Putsche in der zweiten Hälfte des 20. Jh. (von Vietnam bis Lateinamerika) dienten oft als Stellvertreterkonflikte, um den Machtbereich der USA oder UdSSR zu verteidigen bzw. auszubauen. Regime- und Systemkonflikte – bei denen es um die politische Ordnung oder Vormacht in einem Gebiet geht – gelten statistisch als häufigste Ursache gewaltsamer Konfliktebpb.de. Machterhalt als Motiv erkennt man auch daran, dass Krisen von Regierungen instrumentalisiert werden, um autoritäre Maßnahmen zu rechtfertigen (Notstandsgesetze, Verschiebung von Wahlen, Ausschalten der Opposition). Hier überschneiden sich Macht- und Profitinteressen: Wer an der Macht bleibt, wahrt zugleich persönlichen Zugang zu Ressourcen und Patronage-Netzwerken.
- Rohstoffe und Ressourcen: Materielle Ressourcen sind ein klassischer Auslöser von Konflikten – „Der Kampf um Ressourcen ist mittlerweile die zweithäufigste Konfliktursache“, heißt es in einer Analyse der Bundeszentrale für politische Bildungbpb.de. Öl, Gas, Mineralien, seltene Erden, Wasser, Land – der Zugang zu lebenswichtigen oder profitträchtigen Ressourcen weckt Begehrlichkeiten bei Staaten und Konzernen. Viele Kriege des 20. Jahrhunderts hatten eine Ressourcendimension: Im Zweiten Weltkrieg zielte die deutsche Eroberungspolitik („Lebensraum im Osten“) wesentlich auf Getreide, Kohle und Öl der eroberten Gebiete ab; Japans Expansion in Asien sollte Rohstoff-Nachschub (Gummi, Erz, Öl) sichern. Im Nahen Osten waren Erdölreserven wiederholt im Zentrum von Konflikten – vom Golfkrieg 1991 bis zum Irakkrieg 2003, der von Kritikern unverblümt als Krieg um Öl bezeichnet wurdetaz.de. Tatsächlich profitierte z. B. ExxonMobil als größter Gewinner unter den Ölfirmen erheblich vom Ölpreisanstieg infolge der US-Invasion 2003theguardian.com. Ressourcenmangel und -reichtum können gleichermaßen Konflikte nähren: In Afrika finanzierten „Blutdiamanten“ Bürgerkriege, während Wasserknappheit in Regionen wie dem Nahen Osten die Spannung zwischen Staaten erhöht. Laut dem Heidelberger Konfliktbarometer spielte 2017 in 97 von 385 Konflikten der Welt Ressourcenmangel oder -verteilung eine Rollebpb.de. Besonders riskant wird es, wenn Ressourcenfragen mit Sicherheitsbedenken und Ideologie verknüpft werden. Dann werden Rohstoffe als vital für die eigene Nation deklariert und jeder Konkurrenzkampf darum als existenzielle Bedrohung aufgefasstbpb.de. In solchen Fällen – man spricht von „Versicherheitlichung“ – dienen Ressourceninteressen als Vorwand, um militärische Gewalt anzuwenden und politische Ziele wie Gebietsansprüche, Vorherrschaft oder Machterhalt durchzusetzenbpb.de. Konflikte um Öl, Gas oder seltene Mineralien eskalieren so besonders heftig, da wirtschaftliche und machtpolitische Motive ineinandergreifen.
- Technologische Dominanz: Im 20. Jh. entschied technischer Fortschritt über militärische und ökonomische Stärke – man denke an das Atomwaffen-Monopol, das die USA 1945–49 außenpolitisch dominanter machte, oder das „Space Race“ im Kalten Krieg, bei dem Prestige und Abschreckung auf dem Spiel standen. Im 21. Jahrhundert ist der globale Wettbewerb um Spitzentechnologien selbst zu einem Krisenfaktor geworden: „Der Systemwettbewerb zwischen den USA und China […] gerade auch in der Hochtechnologie [prägt] die aktuelle geopolitische Dynamik. Dominanz z. B. bei Künstlicher Intelligenz (KI), Quantencomputing und in der Halbleiterproduktion ist zu einem entscheidenden Machtfaktor geworden“agora-strategy.com. Tatsächlich sprechen Experten von einem neuen Tech-Wettrüsten: Staaten investieren milliardenfach in KI-Forschung, 5G-Netze, Cyber-Abwehr, Raumfahrt und Halbleiter, um strategische Vorteile zu erlangen. Diese technologische Rivalität birgt Spannungen – etwa Sanktionen und Handelskriege um Chip-Technologie zwischen den USA und China. Die zugrunde liegenden Interessen sind sowohl wirtschaftlicher Natur (zukünftige Billionenmärkte sichern) als auch militärisch (KI als Schlüssel für autonome Waffensysteme, Überwachung und Geheimdienst). Technologischer Vorsprung wird zum Machtmultiplikator: Wer Standardsetzer bei Zukunftstechnologien ist, kann Abhängigkeiten der anderen schaffen. Somit verstärken Ambitionen zur Technologiedominanz internationale Konflikte und führen intern zu einem Schulterschluss von Staat und Tech-Industrie (z. B. staatlich geförderte KI-Programme, Militärforschung in Kooperation mit IT-Giganten). Europa spürt diesen Druck ebenfalls und ringt um eine Position, um nicht zwischen US und China zerrieben zu werdenagora-strategy.com.
- Marktbeherrschung und wirtschaftliche Interessen: Neben physischen Ressourcen und Technologien sind auch Absatzmärkte, Kapital und finanzielle Vorherrschaft häufige Krisentreiber. In globalisierten Wirtschaftssystemen können Krisen gezielt genutzt werden, um Marktmacht zu konzentrieren. Beispiel Finanzkrise 2008: Die implodierenden Banken wurden durch Staatshilfen gerettet, aber das Ergebnis war oft eine weitere Marktkonzentration – große Banken schluckten konkurrierende Institute, die Krise beschleunigte den Trend zu einigen wenigen Mega-Banken. Ähnlich verdrängte im Zuge der Corona-Pandemie der Online-Handel viele stationäre Händler, was E-Commerce-Riesen quasi ein Monopol in bestimmten Bereichen verschaffte. Wirtschaftliche Notlagen schaffen oft „Kaufgelegenheiten“ für Große: Investoren kaufen in der Rezession günstig Unternehmen oder Immobilien auf, erhöhen so ihre Marktanteile, während kleinere Wettbewerber ausscheiden. Diese „Krise als Konsolidierungschance“-Logik findet man auch branchenübergreifend: Etwa konnten nach der Ostblock-Öffnung westliche Konzerne schnell die Märkte dominieren – oft begünstigt durch neoliberale Schocktherapie-Reformen. Der Drang zur Marktbeherrschung kann auch Krisen entfesseln: Handelskriege werden vom Kalkül geleitet, eigene Industrien zu schützen oder fremde zu schwächen (Beispiel: aktuelle US/China-Konflikte um Handelsbilanzen und Zölle). Kriege zerstören die Industrie der Verlierer und schaffen Raum für Exporteure der Siegerseite (nach 1945 beherrschten US-Unternehmen in vielen Ländern, vom Ölgeschäft bis zur Unterhaltungskultur, den Markt mangels Konkurrenz). Letztlich liegt vielen Krisen ein System zugrunde, in dem Profitmaximierung und Wettbewerbsvorsprung gewichtige Antriebe sind. Ist ein Markt gesättigt oder reguliert, können Krisen oder Schocks neue Profitchancen eröffnen – ob durch Deregulierung, Zerstörung von Überkapazitäten oder staatliche Wiederaufbauprogramme.
Man sieht: Interessen wie Macht, Rohstoffe, technologische oder finanzielle Dominanz sind häufig miteinander verflochten. Sie verstärken Krisen oder werden durch Krisen bedient. So führte etwa die Kombination aus Ressourcenhunger und Machtstreben im Nahen Osten zu anhaltenden Kriegen, oder der Wunsch nach technologischer Führerschaft erzeugt heute ein permanentes Spannungsfeld zwischen Großmächten. Diese Interessen erklären, warum Krisen nicht selten bewusst in Kauf genommen oder sogar geschürt werden, um langfristige Vorteile zu erlangen („cui bono“ liefert hier einen Hinweis auf mögliche Profiteure). Doch wie setzen diese Akteure ihre Vorteile konkret durch? Hier kommen die Mechanismen der Einflussnahme ins Spiel.
Mechanismen zur Sicherung von Einfluss und Profit in Krisenzeiten
Profiteure von Krisen nutzen verschiedene Hebel und Strategien, um in turbulenten Zeiten ihren Vorteil zu sichern oder auszubauen. Zu den wichtigsten Mechanismen gehören:
- Lobbyismus und „militärisch-industrieller Komplex“: Mächtige Interessengruppen beeinflussen aktiv die Politik, damit Entscheidungen in ihrem Sinne ausfallen. Im Rüstungssektor warnte bereits US-Präsident Dwight D. Eisenhower 1961 eindringlich vor den Verflechtungen von Politik, Militär und Waffenindustrie: Er mahnte, man müsse sich „vor unbefugtem Einfluss – ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt – durch den militärisch-industriellen Komplex schützen“, da andernfalls „das Potenzial für die katastrophale Zunahme fehlgeleiteter Kräfte“ bestehede.wikipedia.org. Eisenhower fürchtete, dass die Politik durch die Interessen der Rüstungslobby verleitet werden könnte, Konflikte eher militärisch zu lösen und quasi zum „verlängerten Arm der Lobby der Rüstungsindustrie“ zu werdende.wikipedia.org. Diese Warnung war prophetisch: Tatsächlich hat sich in vielen Ländern ein Einflussgeflecht etabliert, in dem Rüstungskonzerne über Lobbyisten, Think-Tanks und das Prinzip der „Drehtür“ (Wechsel von Entscheidungsträgern in Industriejobs und umgekehrt) sicherstellen, dass hohe Verteidigungsbudgets und interventionistische Strategien politisch mehrheitsfähig bleiben. In den USA besetzten z. B. unter Präsident Trump zahlreiche ehemalige Rüstungsmanager Schlüsselpositionen im Pentagon, wodurch enorme Budgetsteigerungen für Militär und Heimatschutz im Jahr 2017/18 durchgewinkt wurdentheguardian.comtheguardian.com. Auch im Energiebereich oder Gesundheitssektor wirkt Lobbyismus: Fossile Energieunternehmen investierten über Jahrzehnte in PR und Lobbyarbeit, um Klimaregulierung zu verzögern – sie finanzierten „Klimaskeptiker“-Studien und pflegten enge Kontakte zu Entscheidungsträgern, um ihre Öl- und Gasgeschäfte vor CO₂-Steuern oder Auflagen zu schützen. Pharma- und Finanzlobbys nutzen Krisen, um für staatliche Hilfen oder günstige Regulierung zu werben (z. B. Bankenverband in der Eurokrise für Rettungspakete, Pharmafirmen für Abnahmegarantien bei Impfstoffen). Kurzum: Lobbygruppen sichern in Krisenzeiten ihre Profite, indem sie politischen Einfluss mobilisieren – sei es durch persönliche Netzwerke, mediale Kampagnen oder finanzielle Zuwendungen an Parteien.
- Medienmacht, Propaganda und Krisenrhetorik: Die Deutungshoheit über eine Krise ist selbst eine Machtressource. Medien können genutzt werden, um Panik oder Zustimmung zu erzeugen und damit bestimmte Maßnahmen zu legitimieren. Naomi Klein beschreibt in ihrer Schock-Strategie genau dieses Muster: Regierungen warten einen Schock ab (oder provozieren ihn mitunter), rufen dann eine Phase „außerordentlicher Politik“ aus, in der normale Debatten und Rechte ausgesetzt werden, und setzen im Eiltempo unpopuläre Maßnahmen durchtheguardian.com. Hysterische Krisenrhetorik spielt dabei eine Schlüsselrolle: „Nahezu jede tumultartige Situation, wenn sie von politischen Führern mit genügend Hysterie gerahmt wird, kann die Bevölkerung gefügig machen“theguardian.com. Ob ein Militärputsch oder ein Finanzcrash – wird der Ernst der Lage drastisch beschworen, akzeptiert die verängstigte Öffentlichkeit Maßnahmen, die sonst undenkbar wären (etwa den Abbau von Sozialleistungen oder milliardenschwere Banken-Rettungen)theguardian.com. Historisch wurde Propaganda systematisch in Weltkriegen eingesetzt (Feindbilder, Durchhalteparolen), im Kalten Krieg schürten Medien die Angst vor dem jeweils anderen Block, um Rüstungsprogramme zu rechtfertigen. Nach 9/11 verbreiteten regierungsnahe Medien die Doktrin vom „Krieg gegen den Terror“ global, was half, Interventionen in Irak oder Afghanistan trotz zweifelhafter Begründungen (Stichwort Massenvernichtungswaffen-Lüge) innenpolitisch zu tragen. Zensur und Desinformation sind weitere Werkzeuge: So finanzierte ExxonMobil laut Recherchen jahrelang Desinformationskampagnen, um den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel zu untergraben – obwohl der Konzern intern längst um die Realität der Erderwärmung wusstetheguardian.com. Gleichzeitig bereitete Exxon sich hinter den Kulissen auf die Folgen der Klimakrise vor (etwa durch Ölbohrprojekte in der schmelzenden Arktis und das Höherlegen von Raffinerien als Schutz gegen Meeresspiegelanstieg)theguardian.com. Informationskontrolle verschafft also zeitlichen Gewinn und Profit, indem sie öffentliche Gegenwehr schwächt. Auch neuere Phänomene wie Social Media werden instrumentalisiert: In Krisen verbreiten sich Gerüchte und manipulative Narrative rasend schnell online – hiervon profitieren etwa Extremisten oder Verschwörungsunternehmer, die mit Vereinfachungen eigene Ziele (Macht oder Geld) verfolgen. Insgesamt gilt: Wer die Geschichte einer Krise erzählt, steuert auch die Reaktionen darauf. Mächtige Akteure setzen daher in Krisenzeiten auf mediale Dominanz – sei es durch eigene Sender, gekaufte Experten oder koordinierte PR.
- Ausnahmezustand und Notfallbefugnisse: Rechtliche Ausnahmezustände geben Regierungen Spielraum, den sie zum Machtausbau nutzen können. In vielen Ländern erlauben Verfassungen im Notstand die Suspension von Grundrechten, das Regieren per Dekret oder das Ausschalten von Kontrollinstanzen. Solche Befugnisse mögen in echten Notlagen nötig sein, doch sie bieten auch Missbrauchspotential: Autoritäre Herrscher verhängen immer wieder den Notstand, um Gegner auszuschalten (z. B. wiederholte Notstandsregimes in der Türkei, Ägypten oder Thailand, die eigentlich Dauerzustand sind). Aber auch Demokratien greifen auf Notstandslogik zurück. Nach 9/11 verabschiedeten die USA mit dem Patriot Act weitreichende Überwachungs- und Eingriffsmöglichkeiten, welche die Bürgerrechte einschränkten – begründet durch den „Krieg gegen den Terror“. Diese Maßnahmen traten nie vollständig zurück; der temporäre Ausnahmezustand normalisierte sich und sicherte Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden langfristig mehr Einfluss. Ähnliches galt in Frankreich nach den Terroranschlägen 2015: Der verhängte Ausnahmezustand wurde mehrfach verlängert, und manche Befugnisse (wie erweiterte Polizeigewalt) gingen danach ins Dauerrecht über. In der COVID-19-Pandemie sah man weltweit Notstands-Verordnungen, teils mit Ausgangssperren und erheblichen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. Dadurch konzentrierte sich Entscheidungsgewalt in Exekutivhänden. Profiteure des Ausnahmezustands sind jene an der Macht – sie können im Schatten der Krise Agenden durchsetzen, ohne übliche Parlamente oder Proteste fürchten zu müssen. Wirtschaftlich profitieren oft nahe stehende Unternehmen durch Schnellvergaben im Notstand (z. B. Direktvergaben von Masken- oder Impfstoff-Beschaffungsverträgen an bestimmte Lieferanten, was in mehreren Ländern Korruptionsskandale nach sich zog). Kurz: Der Ausnahmezustand ist ein Hebel, um demokratische Prozesse zu umgehen und Entscheidungen zu zentralisieren – ideal für Eliten, um ihre Position zu festigen oder um umstrittene Projekte an der Öffentlichkeit vorbei umzusetzen.
- Public-Private-Partnerships und die Privatisierung von Krisenlösungen: In Krisenzeiten arbeiten öffentliche Hand und Privatwirtschaft oft eng zusammen – sei es aus Notwendigkeit oder politischer Absicht. Solche öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) können nützlich sein (etwa beim schnellen Ausbau von Infrastruktur nach Naturkatastrophen oder der Entwicklung von Impfstoffen durch staatlich finanzierte Forschung in Pharmafirmen). Gleichzeitig eröffnen PPPs der Privatwirtschaft enorme Verdienstmöglichkeiten auf Staatskosten. Beispielsweise wurden im Irak- und Afghanistan-Krieg umfangreiche militärische Dienstleistungen (Logistik, Verpflegung, Sicherheit) an Privatfirmen übertragen – Unternehmen wie Blackwater (Söldnerdienste) oder Halliburton (Öl und Bau) erhielten lukrative Verträge mit garantierter Gewinnmarge. Oft wurden diese Verträge im Eiltempo und ohne Wettbewerb vergeben, da der Notfall es angeblich erfordertecbsnews.com. Die Rekonstruktion von Krisengebieten (vom Nachkriegseuropa 1945 bis zu heutigen Konfliktländern) geschieht häufig durch PPP-Modelle: Internationale Geber zahlen, private Baufirmen setzen um – was nicht selten zu Kostenexplosionen und Bereicherung führte. Kritiker sprechen in diesem Zusammenhang von „Katastrophen-Kapitalismus“, wie ihn Naomi Klein anprangert: Nach Hurrikan Katrina (2005) etwa vergab die US-Regierung riesige Summen an private Auftragnehmer für den Wiederaufbau in New Orleans – einige Firmen kassierten, leisteten aber mangelhafte Arbeit, während öffentliche Gelder versickertentheguardian.comtheguardian.com. PPP-Mechanismen sichern Einfluss, indem sie ökonomische Interessen in die staatliche Krisenantwort integrieren: Unternehmen, die mit Regierungen partnerschaftlich verbunden sind, können in Ausnahmesituationen fast risikolos Gewinne einfahren (Kosten trägt der Staat) und erhalten zugleich Mitsprache bei politischen Prioritäten. So entsteht eine Verquickung von Staat und Konzern – im besten Fall eine effiziente Allianz zur Problemlösung, im schlimmsten Fall ein Kartell zulasten der Allgemeinheit.
All diese Mechanismen – Lobbyismus, Medienkontrolle, Notstandsrecht, PPP – funktionieren wie Hebel, die Profiteure in der Krise betätigen, um ihre Ziele durchzusetzen. Oft greifen sie ineinander: Eine Krise wird rhetorisch aufgebauscht, um Notstandsmaßnahmen zu legitimieren; Lobbyisten sorgen dafür, dass Hilfsgelder oder Aufträge an bestimmte Unternehmen fließen; Medien lenken von Korruption ab, indem sie patriotische Narrative verbreiten usw. So sichern sich die Gewinner von Krisen nachhaltig ihren Vorteil, während die eigentlichen Krisenursachen häufig unangetastet bleiben.
Beispiele: Vom Weltkrieg bis zur KI – Cui bono? in der Praxis
Um die obigen Analysen greifbar zu machen, lohnt ein Blick auf exemplarische Krisen des 20. und 21. Jahrhunderts und ihre jeweiligen Profiteure und Interessen:
- Weltkriege (1914–1918, 1939–1945): Die Rüstungsindustrie in allen beteiligten Ländern erlebte einen beispiellosen Boom; insbesondere neutrale Staaten wie die Schweiz profitierten finanziell durch Bankgeschäfte und Waffenhandel. In beiden Weltkriegen entstanden Kriegsgewinnler, die aus Rüstung, Schwarzmarkt und Auftragsfertigung enorme Vermögen schlugende.wikipedia.orgde.wikipedia.org. Politisch gehörten die Siegermächte zu den Profiteuren: Großbritannien und Frankreich sicherten sich nach dem Ersten Weltkrieg koloniale Gebiete der besiegten Mächte, nach dem Zweiten Weltkrieg stiegen USA und UdSSR zu Supermächten auf. Strukturelle Interessen wie Rohstoffe (Ölfelder im Nahen Osten, Gummi und Zinn in Südostasien) spielten eine Rolle in Strategien und Bündnissen. Mechanismen: intensive Propaganda („Heimatfront“), totale Mobilmachung der Wirtschaft (Kriegswirtschaft) und Alliierung von Staat und Konzernen (wie in den USA das War Production Board, das Großkonzernen Auftragsgarantien gab). Profiteur global war auch die US-Wirtschaft: Europas Zerstörung ließ die USA als unangefochtene industrielle Führungsmacht zurück; US-Konzerne expandierten in neue Märkte, der Dollar wurde Leitwährung.
- Kalter Krieg (ca. 1947–1990): Profiteure waren die Militär- und Geheimdienstapparate beider Blöcke sowie die damit verflochtene High-Tech-Industrie. Das Wettrüsten füllte über Jahrzehnte die Auftragsbücher von Waffenherstellern (Atomwaffen, Panzer, Jets) – allein in den USA flossen Abermilliarden in Projekte wie die Apollo-Mondlandung, die zugleich zivile Technologiebranchen beflügelten (Elektronik, Computerentwicklung). Die Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen (Lockheed, Boeing, IBM etc.) entwickelten sich zu einflussreichen Konzernen. Politisch festigte der Ost-West-Konflikt die Macht der jeweiligen Eliten: So rechtfertigten sich Diktaturen im Osten wie im Westen (etwa US-Unterstützung für autoritäre Anti-Kommunisten in Lateinamerika) mit der Systemkonfrontation. Strukturelle Interessen: ideologische Dominanz (Ausbreitung von Kapitalismus vs. Sozialismus), Zugang zu Ressourcen und Absatzmärkten in der Dritten Welt (viele Stellvertreterkriege hatten Rohstoffkomponenten, etwa Konflikte in Afrika um Uran oder Öl). Mechanismen: Propaganda (Angst vor dem „bösen Feind“ hielt Bevölkerungen gefügig), Geheimoperationen (CIA, KGB destabilisierten unliebsame Regierungen) und Rüstungs-Lobby (Eisenhowers militärisch-industrieller Komplex entstand in dieser Ära und übte permanent Druck für hohe Verteidigungsbudgets ausde.wikipedia.org).
- Internationaler Terrorismus und „Krieg gegen den Terror“ (2001–heute): Die Anschläge vom 11. September 2001 lösten eine Kette von Konflikten (Afghanistan-, Irakkrieg) und globalen Sicherheitsmaßnahmen aus. Profitiert haben in erster Linie die Sicherheitsapparate und Rüstungskonzerne der westlichen Welt: Die Pentagon-Budgets stiegen ins Unermessliche, private Militärfirmen erhielten Aufträge, die Überwachungsindustrie (Drohnen, Biometrie, IT-Sicherheit) boomte. Bis zu 7 Billionen $ aus den US-Kriegsbudgets flossen an Unternehmenwatson.brown.edu – ein gigantischer Geldtransfer vom Staat an die Privatwirtschaft. Auch Energiekonzerne erhielten Vorteile: der Irakkrieg sicherte westlichen Firmen langfristig Zugriff auf irakisches Öl, und die hohen Ölpreise in den 2000ern füllten die Kassen der Branchetheguardian.com. Politisch profitierte ein neokonservatives Establishment in den USA, das seine strategische Agenda (Demokratisierung des Nahen Ostens, Ausbau der US-Hegemonie) unter dem Deckmantel Terrorbekämpfung vorantreiben konnte. Autoritäre Regime weltweit nutzten den „Anti-Terror“-Diskurs, um innere Gegner als Terroristen zu brandmarken. Strukturelle Interessen hier: Geopolitische Neuordnung (Nahost kontrollieren), Ressourcensicherung (Öl/Gas), militärische Präsenz in strategischen Regionen. Mechanismen: Angstnarrative (ständig erhöhte Terrorwarnstufen), Patriotismus (wer kritisierte, galt als unpatriotisch), Notstandsgesetze (Guantanamo, Folter-Memos wurden als notwendig verkauft). Die langfristige Konsequenz war ein massiv ausgebauter Sicherheitssektor und teils erosierte Bürgerrechte – wovon die beteiligten Institutionen und Firmen nachhaltig profitieren.
- Klimakrise: Die sich zuspitzende Klimakatastrophe ist primär eine Tragödie, doch auch hier gibt es Cui bono-Aspekte. Fossile Energiekonzerne waren lange indirekte Profiteure der Untätigkeit in der Klimapolitik: Jede verschleppte Emissionsbremse erlaubte ihnen, weiter Profite aus Öl, Kohle und Gas zu ziehen. Einige Konzerne wie Exxon wussten früh um die Risiken, entschieden sich aber bewusst, Klimawissenschaft zu sabotieren und zugleich Strategien zu entwickeln, um aus der Erwärmung Vorteile zu ziehentheguardian.com – etwa Exploration neuer Ölquellen in auftauenden Arktisgebietentheguardian.com. Strukturelle Interessen hinter der Klimakrise sind Ressourcen- und Entwicklungsinteressen: Industrieländer und aufstrebende Mächte wollten billige Energie zur wirtschaftlichen Expansion, was die Emissionen jahrzehntelang steigen ließ. Heute entstehen jedoch neue Profiteure: Der Druck zur Dekarbonisierung schafft boomende Branchen (erneuerbare Energien, E-Mobilität, CO₂-Zertifikatehandel). Wer rechtzeitig in Green Tech investiert hat, steht nun vor enormen Gewinnen, da Politik und Verbraucher umschwenken. Auch Finanzinvestoren verdienen an der Klimakrise – z. B. durch Spekulation auf Nahrungsmittel bei Dürren oder den Aufkauf von Land in klimastabileren Regionen (Klimaflüchtlinge verstärken Landwerte in sicheren Ländern). Mechanismen: Ein Mix aus Lobbyismus (jahrzehntelang durch Klimaleugner-Lobby), globaler Diplomatie (blockierte Klimagipfel) und Narrativsteuerung (heute positiver: „Green Economy“ als neues Wachstumsfeld). Gleichzeitig nutzen Regierungen die „Klimanotlage“, um weitreichende Transformationen durchzusetzen – sinnvoll für Nachhaltigkeit, aber auch eine Gelegenheit, industrielle Politik zu gestalten, von der heimische Konzerne profitieren können (Subventionen für E-Autos, Wasserstoff etc.).
- Pandemie (COVID-19): Die Corona-Pandemie stürzte die Welt ab 2020 in eine Gesundheits- und Wirtschaftskrise. Profiteure waren hier vor allem Technologie- und Online-Unternehmen sowie Pharma- und Medizinkonzerne. Lockdowns und Social Distancing bedeuteten einen digitalen Boom: Firmen wie Amazon, Zoom oder Netflix gewannen Hunderte Millionen neue Kunden; die digitalen Monopolisten konnten kleinere Wettbewerber abhängen und ihre Marktmacht ausbauen. Pharmaunternehmen wie Pfizer, Moderna oder BioNTech erzielten durch Impfstoffverkäufe Milliardengewinne, oft unterstützt durch öffentliche Forschungsgelder und Vorabkaufverträge. Reiche Privatpersonen wurden noch reicher – wie erwähnt, erlebten Milliardäre einen historischen Vermögensanstiegdiw.dediw.de. Strukturell zeigt die Pandemie, wie Ungleichheit sich in Krisen auswirkt: Wer Kapital hatte, konnte investieren und profitieren (z. B. in volatile Aktienmärkte), während viele Arbeitnehmer Einkommen verloren. Politisch konnten einige Regierungen ihren Handlungsspielraum erweitern (siehe Ausnahmezustand). Mechanismen hier: Notstandsauftragsvergabe (Regierungen schlossen enge Partnerschaften mit Pharma- und Tech-Firmen), mediale Fokussierung (teils wurden Kritikpunkte – z. B. an Datenschutz von Tracing-Apps oder an Übergewinnen – als unsolidarisch diskreditiert) und Lobbyarbeit der Gewinnerbranchen (Big Tech verhinderte z. B. strengere Regulierungen während der Krise, da digitale Dienste als systemrelevant galten). Das Ergebnis: eine noch stärkere Stellung der großen Digitalkonzerne und Pharmariesen nach der Krise, abgesichert durch staatliche Zusammenarbeit und Datenzugang.
- Digitalisierung und KI: Auch jenseits konkreter Krisen wie Kriege oder Pandemien lässt sich fragen: „Cui bono?“ bei disruptiven Entwicklungen wie der Künstlichen Intelligenz. Hier sind die Profiteure klar erkennbar: Tech-Konzerne mit Zugang zu riesigen Datensätzen und Rechenleistung (Google, Microsoft, OpenAI etc.) sowie Staaten, die KI für Überwachung und Militär nutzen können. Die digitale Revolution hat Monopolstrukturen hervorgebracht – ein Unternehmen wie Google profitiert von jeder digitalen Informationsflut, da seine Werbeeinnahmen mit der Online-Nutzung steigen. Künstliche Intelligenz wird zum Machtfaktor (siehe oben Tech-Wettrüsten): „Dominanz bei KI und Halbleitern ersetzt traditionelle Machtformen“agora-strategy.com – somit profitieren die Länder und Firmen, die diese Dominanz erreichen. Hier spielen strukturelle Interessen (technologische Vorherrschaft, neue Märkte) und Mechanismen (staatliche Förderprogramme, Patentschutz, gezielte Forschungskooperationen) zusammen. Krisenrhetorik gibt es auch im Digitalbereich: Die Rede vom „KI-Arms Race“ sorgt dafür, dass Regierungen enorme Summen in wenige Hände leiten, um nicht „zurückzufallen“. Die Frage „Wem nützt KI?“ lässt sich also beantworten mit: Denjenigen, die schon jetzt die Kontrolle über Daten und Algorithmen haben – und die mittels Regulierungseinfluss und Marktgewicht ihre Stellung halten. Für die Gesellschaft bringt KI Chancen, aber auch Risiken von Jobverlust bis Überwachung – wer hier profitiert, hängt davon ab, ob rechtzeitig gegengesteuert wird oder die bestehenden Profiteure die Regeln schreiben.
Diese Fallbeispiele zeigen im Konkreten, was abstrakt bereits analysiert wurde: Krisen und tiefgreifende Umwälzungen bringen stets bestimmte Gewinner hervor. Oft sind es dieselben Kreise – militärisch-industrielle und finanzielle Eliten, Großmächte, multinationale Konzerne – die aus sehr unterschiedlichen Krisen Nutzen ziehen. Cui bono entlarvt hierbei, dass Kriege, Katastrophen oder disruptive Veränderungen selten „Zufall“ oder reines Pech sind, sondern in bestehende Macht- und Profitlogiken eingebettet werden.
Kritisches Fazit
Die Frage „Wem nützt es?“ eröffnet einen kritischen Blick hinter die Kulissen von Krisen im 20. und 21. Jahrhundert. Die vorangegangene Analyse legt nahe, dass Krisen systematisch asymmetrische Nutzen bringen: Während breite Bevölkerungsschichten die Kosten von Kriegen, Pandemien und Umweltkatastrophen tragen, gelingt es bestimmten Akteuren, Vorteile und Gewinne daraus zu ziehen – seien es Staaten, Konzerne oder Elitengruppen. Historische und aktuelle Beispiele untermauern dieses Muster. Es wäre jedoch zu einfach, jede Krise als bewusst inszeniertes Komplott der Profiteure abzutun. Vielmehr zeigt sich eine Art „Janusgesicht“ der Krise: Einerseits entstehen Krisen aus realen Widersprüchen, Fehlern oder Zufällen – andererseits werden sie rasch instrumentalisiert, um bestehende Macht- und Vermögensverhältnisse zu festigen oder zu erweitern.
Dabei sind strukturelle Interessen der Schlüssel zum Verständnis: Ob Machterhalt, Ressourcensicherung, Markt- oder Technologiedominanz – stets bieten Krisen einen Anlass, solche Ziele voranzutreiben, wenn die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gebunden und Widerstand gelähmt ist. Die untersuchten Mechanismen – Lobbyismus, mediale Steuerung, Notstandsrecht, öffentlich-private Allianz – bilden das Handwerkszeug, mit dem Krisengewinner ihre Vorteile umsetzen. Je ausgefeilter diese Werkzeuge, desto „erfolgreicher“ die Profiteure: So entstand ein ganzes System des Disaster Capitalism, in dem Schockmomente gezielt genutzt werden, um wirtschaftliche und politische Agenden durchzusetzentheguardian.comtheguardian.com.
Ein kritisches Fazit muss allerdings auch die Gefahr von Kurzschlüssen betonen: Die Frage Cui bono? darf nicht die Komplexität von Krisen auf eine einzige Nutzenrechnung reduzieren. Nicht jeder, der profitiert, hat die Krise verursacht – manche Krisen entstehen aus systemischen Zwängen oder Dynamiken, die niemand allein steuert. Verschwörungstheorien neigen dazu, aus dem berechtigten Cui-bono-Denken falsche Schlüsse zu ziehen, indem sie Absicht unterstellen, wo oft Opportunismus oder Systemlogik am Werk sind. Dennoch: Die Analyse der Profiteure offenbart Machtasymmetrien, die es zu hinterfragen gilt, wenn wir aus Krisen lernen wollen. Sie zeigt, wer zur Kasse gebeten wird und wer kassiert – ein zentraler Aspekt von Gerechtigkeit.
Für die Zukunft bedeutet dies: Eine resiliente, gerechtere Gesellschaft muss Mechanismen etablieren, die Krisenprofite begrenzen und Gewinne in Verantwortung ummünzen. Das könnte heißen, Kriegsgewinnlern durch Steuern und Transparenz das Handwerk zu legen, in Pandemien Übergewinne abzuschöpfen, Lobbyismus strenger zu regulieren und in der Klimakrise die Kosten nicht den Schwächsten aufzubürden. Zudem ist eine wachsame Öffentlichkeit nötig – ganz im Sinne Eisenhowers – um „fehlgeleitete Kräfte“ in Schach zu haltende.wikipedia.org. Nur wenn Bürgerinnen und Bürger informierter und kritischer hinterfragen, wem politische Entscheidungen wirklich nutzen, kann das Cui bono nicht länger im Verborgenen wirken. Krisen wird es immer geben – doch ob sie zum „Vorteil weniger“ oder zum Anstoß für allgemeines Wohl gereichen, liegt an den Regeln, die wir als globale Gemeinschaft setzen.