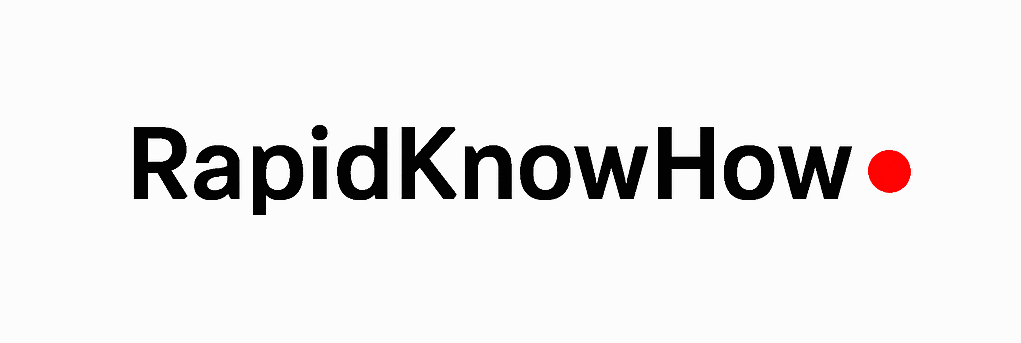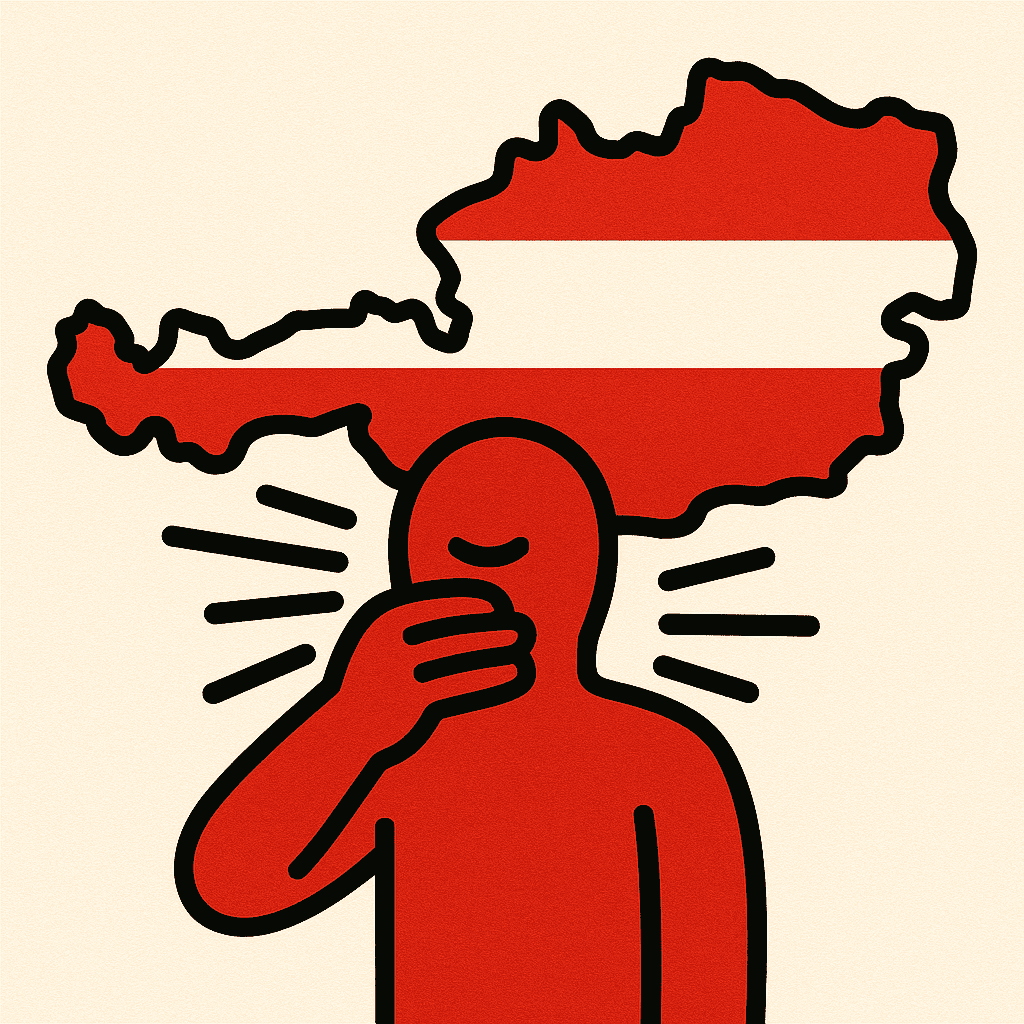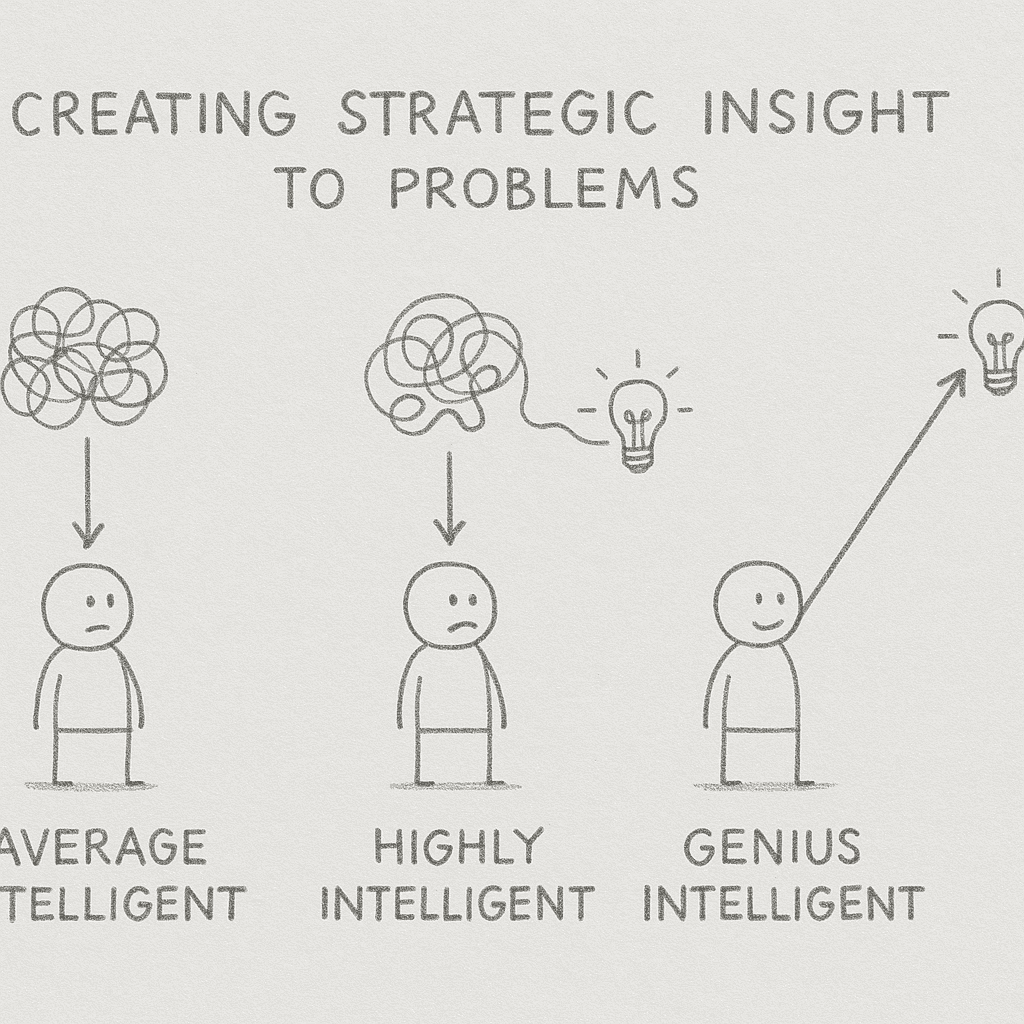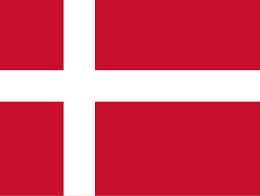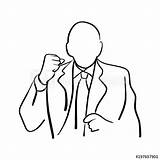Österreich 1945–2025: Von der „Insel der Seligen“ zum „Land ohne Eigenschaften“ ?!
Einführung: Selbstbild zwischen Idylle und Identitätslosigkeit
Bruno Kreisky prägte in den 1970er-Jahren das Bild Österreichs als „Insel der Seligen“, womit er den erfolgreichen Aufbau des Sozialstaats, die immerwährende Neutralität und den sozialen Frieden der Zweiten Republik hervorhobde.wikipedia.org. Demgegenüber steht die ironische Übertragung von Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“ auf Österreich – das „Land ohne Eigenschaften“ –, etwa durch den Schriftsteller Robert Menasse in den 1990ern, als Sinnbild für fehlende klare Identität und unkritische Selbstzufriedenheitkatalog.borgmistelbach.ac.at. Tatsächlich pendelt Österreichs Entwicklung seit 1945 zwischen Selbstlob und Selbstkritik. Im folgenden Bericht werden zentrale politische und gesellschaftliche Aspekte analysiert – von politischer Kultur und Sozialstaat über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit bis zu Migration, Bildung und Medien –, um kritisch zu beleuchten, ob Österreich eher die selige Insel oder ein Land ohne ausgeprägte Eigenschaften ist.
(Hinweis: Chronologische Meilensteine – Kreisky-Ära, Waldheim-Affäre, EU-Beitritt 1995, Flüchtlingskrise 2015, Corona-Pandemie u.a. – werden in die thematische Gliederung integriert.)
Politische Kultur und Demokratieverständnis
Die Zweite Republik (ab 1945) etablierte eine Konkordanzdemokratie mit hoher Stabilität. SPÖ und ÖVP – die ehemaligen Bürgerkriegsgegner von 1934 – teilten sich die Macht in großen Koalitionen (1945–1966) und institutionalisiertem Proporz. Dieses System der Verhandlungsdemokratie („Konsenspolitik“) schuf breite Akzeptanz für die repräsentative Demokratie und minimierte offene Konflikte. Österreich erwarb dadurch in der Nachkriegszeit den Ruf einer konfliktarmen Insel der Seligende.wikipedia.org. Bis in die 1980er Jahre waren etwa Streiks extrem selten (auf „Sekunden pro Jahr“ gerechnet)de.wikipedia.org. Die politische Kultur war lange geprägt von informellen Absprachen hinter den Kulissen und einer gewissen Entpolarisierung im Parlament, die kritisiert wurde als „Stillstand“ oder “Parteienherrschaft”.
Doch seit den 1980er-Jahren traten Veränderungen ein: Neue Parteien gewannen an Einfluss (die Grünen zogen 1986 ins Parlament ein, die FPÖ wandelte sich unter Jörg Haider zur rechtspopulistischen Kraft). Die Ära Haider brachte scharfe Rhetorik in die Politik und sprengte 1986 die SPÖ-FPÖ-Koalition. Populismus und Polarisierung nahmen zu, besonders als 2000 die ÖVP mit der FPÖ (Schwarz-Blau) koalierte – ein Bruch mit der Konsens-Tradition, der EU-weite Sanktionen auslöste. Seither wechseln Große Koalitionen (z.B. 2007–2017) mit Phasen polarisierender Rechts-Regierungen (ÖVP-FPÖ 2000–2006, 2017–2019). Insgesamt blieb die Demokratie formell stabil, doch Vertrauen in Politik und Parteien erodierte in den letzten Jahren. Laut einer Werte-Studie 2021 sind zwar 95 % der Bürger weiterhin überzeugte Demokraten, aber nur zwei Drittel finden, dass Österreich tatsächlich demokratisch regiert werde (2018 waren es noch 84 %)profil.at. Unzufriedenheit mit dem Zustand der Demokratie stieg 2021 auf einen Rekordwert von 40 %profil.at – ein Alarmzeichen für die politische Kultur. Skandale (z.B. die „Ibiza-Affäre“ 2019 um FPÖ-Chef Strache oder Korruptionsvorwürfe gegen die Kurz-ÖVP) erschütterten das Vertrauen zusätzlich. In der Corona-Pandemie 2020/21 zeigte sich schließlich eine tiefe Spaltung in der Bevölkerung in Befürworter und Gegner staatlicher Maßnahmen – begleitet von einer Verrohung der Debattenkultur. Insgesamt hat sich Österreichs politische Kultur von konsensualer Harmonie hin zu stärkerer Konfrontation und Lagerbildung entwickelt. Die demokratischen Institutionen funktionieren weiterhin, doch Kreiskys selige Ruhe ist einer lauteren, konfliktreicheren politischen Landschaft gewichen.
Sozialpartnerschaft und Wohlfahrtsstaat
Ein zentraler Pfeiler der „Insel der Seligen“ war die österreichische Sozialpartnerschaft – das enge, korporatistische Zusammenwirken von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden (Wirtschaftskammer, Gewerkschaftsbund, Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer, Industriellenvereinigung) mit der Regierungde.wikipedia.org. Seit den 1950er-Jahren wurden Löhne, Preise und Sozialstandards am Verhandlungstisch einvernehmlich geregelt (etwa in der Paritätischen Kommission)de.wikipedia.org. In den 1970er und 1980er Jahren galt die Sozialpartnerschaft als so mächtig, dass man von einer „Nebenregierung“ sprach – ohne sie ging kaum eine Entscheidungde.wikipedia.orgde.wikipedia.org. Die Vorteile dieses Modells waren sozialer Frieden, planbare Arbeitsbeziehungen (kaum Streiks) und der stetige Ausbau des Wohlfahrtsstaats. Gerade unter Kanzler Kreisky (1970–1983) wurde ein dichtes Netz sozialer Sicherung geknüpft (Erhöhung von Pensionen, Familienbeihilfen, Ausbau des Gesundheitswesens etc.). Das trug wesentlich zum Mythos des prosperierenden, gerechten Österreich beide.wikipedia.org. Wie es ein Politiker formulierte: „Ein funktionierender und als gerecht empfundener Sozialstaat ist das Fundament für die Sicherheit und Stabilität eines Landes“parlament.gv.at – und Garant der demokratischen Ordnung.
Allerdings zog die Sozialpartnerschaft auch Kritik auf sich. Linke wie rechte Oppositionsgruppen monierten ab den 1980ern einen intransparenten „Kuhhandel“, der Parlament und Opposition entmachtede.wikipedia.orgde.wikipedia.org. Tatsächlich waren FPÖ, Grüne und kleinere Parteien vom sozialpartnerschaftlichen Prozess weitgehend ausgeschlossende.wikipedia.org. Jörg Haider wetterte gegen das „Proporzsystem“ und gewann Zuspruch von denen, die das als verkrustete „Allparteienregierung“ empfandende.wikipedia.orgde.wikipedia.org. Mit der FPÖ-Regierungsbeteiligung 2000 wurde die Sozialpartnerschaft dann bewusst geschwächt. Trotzdem genießen die Sozialpartner in der Bevölkerung bis heute Ansehende.wikipedia.orgde.wikipedia.org – man schätzt den Kompromissgeist und die Rolle als Stabilitätsfaktor. In Krisenzeiten – etwa Finanzkrise 2008 oder aktuell Inflation und Energiekrise – besinnt man sich auf das „österreichische Modell“ des runden Tisches. Insgesamt aber hat der ökonomische und gesellschaftliche Wandel (EU-Binnenmarkt, Globalisierung) den Einfluss der Sozialpartner reduziertde.wikipedia.org. Neue Herausforderungen wie atypische Beschäftigung oder Migration werden vom traditionellen Sozialdialog nur bedingt erfasst. Dennoch bleibt der Wohlfahrtsstaat intakt: Österreich rangiert bei Sozialausgaben pro Kopf und Indikatoren wie Lebenszufriedenheit weiterhin in europäischen Spitzenfeldern. Die Sozialpartnerschaft hat Österreich zwar nicht zu einem konfliktfreien Paradies gemacht, aber sie leistete einen wesentlichen Beitrag zum sozialen Frieden, der Kreisky einst zur „Insel der Seligen“ inspiriertede.wikipedia.org.
Österreichische Neutralität und geopolitische Selbstverortung
Österreichs immerwährende Neutralität seit 1955 ist ein Kernstück seines Selbstverständnissesde.wikipedia.org. Nach der Befreiung 1945 und zehn Jahren Alliierter Besatzung erlangte das Land 1955 durch den Staatsvertrag seine Souveränität zurück – verbunden mit dem Versprechen, militärisch neutral zu bleiben (ähnlich der Schweiz)de.wikipedia.org. Die Neutralität war zunächst eine Bedingung der Sowjetunion, entwickelte sich aber rasch zum identitätsstiftenden Mythos: Sie ermöglichte Österreich eine Rolle als Vermittler zwischen Ost und West im Kalten Krieg, als Gastgeber internationaler Organisationen (UNO-Sitz Wien seit 1980) und Konferenzort (z.B. KSZE 1975 in Helsinki mit österreichischer Beteiligung). Die Bevölkerung nahm die Neutralität begeistert an – Umfragen zeigen, dass sie über Jahrzehnte breit akzeptiert und als Teil der österreichischen Identität empfunden wirdde.wikipedia.org. Der 26. Oktober (Tag der Neutralitätserklärung 1955) ist Nationalfeiertag.
Allerdings war die Neutralitätspolitik nie streng „passiv“: Unter Kreisky betrieb Österreich eine aktive Außenpolitik, z.B. Nahost-Vermittlung, und engagierte sich in UNO-Missionen. Mit dem Ende des Kalten Krieges 1989 und dem EU-Beitritt 1995 stellte sich die Frage der Neutralität neu. De facto hat Österreich seine Bündnisfreiheit in der EU angepasst: Man beteiligt sich an der Gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik der EU, Entsendung von Soldaten in EU- oder UNO-Friedensmissionen, und trat 1995 der NATO-Partnerschaft „Partnership for Peace“ beide.wikipedia.orgde.wikipedia.org. Innenpolitisch blieb ein NATO-Beitritt jedoch tabu – die ÖVP schlug ihn zwar zeitweise vor (besonders unter Kanzler Wolfgang Schüssel in den 2000ern), stieß aber auf Widerstand von SPÖ, FPÖ und der meinungsstarken Kronen Zeitung, die das Neutralitäts-Ideal verteidigtende.wikipedia.org. Die Regierungen wagten es aufgrund der klaren Pro-Neutralitäts-Mehrheit der Bevölkerung nicht, offiziell von der „Vollneutralität“ abzurückende.wikipedia.org. In der Praxis ist Österreich also militärisch neutral, aber politisch eng an den Westen gebunden. Dies zeigte sich 2022 deutlich: Beim russischen Angriff auf die Ukraine stellte sich Wien solidarisch auf die Seite der EU-Sanktionen – was von Russland prompt als „Aufgabe der Neutralität“ kritisiert wurdede.wikipedia.org. Intern jedoch hält laut Umfragen weiterhin eine Mehrheit der Österreicher am Neutralitätsprinzip fest und fordert zugleich eine ausreichende eigene Landesverteidigungde.wikipedia.org.
Die Neutralität diente lange als bequemes Außenpolitik-Narrativ: Österreich als „Insel der Seligen“ inmitten der Blockkonfrontation, moralisch unangreifbar und sicher. Mit EU und Globalisierung ist dieses Narrativ komplexer geworden. Dennoch: Die immerwährende Neutralität bleibt ein emotionaler Anker der österreichischen Identität und ein Symbol dafür, sich als „besonders“ in der Welt zu sehen – eben nicht als Teil eines Machtblocks, sondern als kleiner Staat mit humanitärer Tradition (Stichwort „Schutzmacht der UNO“, Friedenstradition). Inwieweit das realistisch ist, bleibt umstritten. Fakt ist, dass Österreich sich geopolitisch gern als Brückenbauer und friedliche „Wohlfühloase“ sieht – was gut zum Bild der seligen Insel passt, aber Kritikern zufolge manchmal in selbstgefällige Außenpolitik ohne klare Kanten mündet (Land ohne Eigenschaften im weltpolitischen Sinne).
Vergangenheitsbewältigung: Umgang mit der NS-Vergangenheit
Nach 1945 tat sich Österreich lange schwer mit der Aufarbeitung seiner Rolle im Nationalsozialismus. Aufgrund der Moskauer Erklärung von 1943 stilisierte man sich als „erstes Opfer“ Hitlers – die sogenannte Opferthese dominierte das offizielle Geschichtsbild. Dieses Narrativ half, die junge Zweite Republik zu integrieren und vom deutschen Nationalismus abzugrenzen, führte aber auch zu Verdrängung: Viele Österreicher waren willige Helfer des NS-Regimes, doch bis in die 1980er wurden Täter oft nicht zur Verantwortung gezogen. So waren ehemalige NSDAP-Mitglieder in Politik und Verwaltung der Nachkriegszeit keine Seltenheit; man schwieg über die Verbrechen, um den inneren Frieden nicht zu gefährden. Dieses bewusste Wegsehen gehörte gleichsam zum „Gründungsmythos“ der Zweiten Republik – „die Opferrolle war Grundlage unseres inneren Friedens nach 1945 und unserer Nachkriegs-Identität“, wie es Kurt Waldheim selbst einmal formuliertewiev1.orf.at.
Erst Skandale rüttelten das Land wach. Der entscheidende Wendepunkt war die Waldheim-Affäre 1986: Recherchen (u.a. vom profil) deckten auf, dass der Präsidentschaftskandidat und ehemalige UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim als Wehrmachtsoffizier in Kriegsverbrechen verstrickt gewesen sein könnte. Die Enthüllung seiner verschwiegenen Vergangenheit löste heftige innen- und außenpolitische Debatten auswiev1.orf.at. Waldheim gewann zwar trotzig die Wahl (Slogan „Jetzt erst recht“), doch der internationale Druck – etwa die US-„Watchlist“-Setzung Waldheims 1987 – und die innere Zerknirschung bewirkten einen Mentalitätswandel. Bundeskanzler Franz Vranitzky bekannte 1991 vor dem Parlament erstmals Mitschuld Österreichs an Nazi-Verbrechen. Historikerkommissionen wurden eingesetzt, Gedenkstätten ausgebaut, Restitutions- und Entschädigungsprogramme gestartet (z.B. Fonds für Zwangsarbeiter in den 2000ern). Beobachter sind sich einig, dass die Waldheim-Debatte der „Startschuss für die längst fällige Aufarbeitung der NS-Vergangenheit“ warwiev1.orf.at. Verdrängungsmechanismen, die zuvor „zum guten Ton gehörten“, waren plötzlich nicht mehr salonfähigwiev1.orf.at.
Waldheim selbst räumte Jahrzehnte später ein, es sei „notwendig, ja unverzichtbar“ gewesen, von der reinen Opferrolle Abschied zu nehmenwiev1.orf.at. Seitdem hat Österreich – wenn auch spät – wichtige Schritte der Vergangenheitsbewältigung unternommen. In den 1990ern wurde z.B. der Holocaust-Mahnmal am Judenplatz in Wien errichtet (2000), Schulunterricht und Forschung zur NS-Zeit intensiviert (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, etc.). Trotzdem blieb die Aufarbeitung nicht ohne Rückschläge: Rechtsextreme oder populistische Politiker versuchten immer wieder, Relativierungen salonfähig zu machen (etwa FPÖ-Politiker mit entgleisenden Sprüchen über die „Ordnungspolitik“ im Dritten Reich etc.). Solche Fälle lösten aber breite Empörung aus. Heute besteht weitgehend Konsens, dass Österreich sowohl Opfer als auch Täter war – diese „Janusköpfigkeit“ der Geschichte ist akzeptiert. Der Prozess der Vergangenheitsbewältigung dauert an, etwa in der Auseinandersetzung um Straßennamen mit NS-Belastung oder die Entschädigung für spezifische Opfergruppen. Insgesamt hat Österreich hier den Wandel vom selbstzufriedenen „Land ohne Eigenschaften“ (das seine dunklen Flecken ignorierte) hin zu einem selbstkritischeren Land geschafft. Dieser schmerzhafte Lernprozess war notwendig, um den demokratischen Wertekanon glaubhaft zu untermauern. Bruno Kreiskys „Insel der Seligen“ war in diesem Punkt jedenfalls eine Illusion – es brauchte Druck von innen und außen, damit Österreich sich seiner Vergangenheit stellte und damit seine kulturelle Identität ehrlicher definierte.
Migration, Integration und Diversität
Österreich war nach 1945 zunächst ein Auswanderungs- und Transitland (viele Menschen flohen vor und nach Kriegsende aus dem zerstörten Mitteleuropa, oft via Österreich). Doch ab den 1960er-Jahren wurde es verstärkt zum Einwanderungsland. Ein erster Schub kam durch die Gastarbeiter-Anwerbung: Zur Zeit des Wirtschaftsbooms holte man ab 1964 Arbeitskräfte aus Jugoslawien und der Türkei ins Land. Diese zunächst als temporär gedachten Migranten blieben häufig dauerhaft, gründeten Familien – die Basis der heutigen türkischstämmigen und balkanstämmigen Minderheiten. In den 1970er-Jahren war Migration politisch wenig thematisiert; Integration erfolgte beiläufig im Arbeitsalltag, aber es gab kaum Konzepte, da man annahm, viele würden zurückkehren. In den 1980ern änderte sich das Bild: Die Zahl der dauerhaft Ansässigen stieg, und erste Spannungen traten auf. 1990 lebten bereits Hunderttausende Personen mit Migrationshintergrund in Österreich.
Weitere Wellen folgten mit geopolitischen Umbrüchen: Die Kriege im zerfallenden Jugoslawien (1991–95) brachten zehntausende Flüchtlinge aus Bosnien und Kroatien, die teils aufgenommen und integriert wurden (viele blieben). 2004/2007 ermöglichte die EU-Osterweiterung neuen Zuzug aus den Nachbarländern (Slowakei, Ungarn, Polen, Rumänien). Am deutlichsten ins öffentliche Bewusstsein rückte das Thema aber während der Flüchtlingskrise 2015: Im Zuge des syrischen Bürgerkriegs und anderer Konflikte erreichten im Spätsommer 2015 rund 90.000 Asylsuchende Österreich – innerhalb weniger Monate eine so große Zahl wie seit 1956 (Ungarn-Aufstand) nicht mehr. Das Land erlebte einerseits eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft (Bürger halfen in Traiskirchen und am Westbahnhof Wien mit Spenden, es gab Applaus für ankommende Familien)orf.at. Andererseits verschärfte sich die politische Polarisierung: Die Regierung (SPÖ-ÖVP) schwankte zwischen „Willkommen“ und Grenzmanagement, während die rechte Opposition (FPÖ) Zulauf mit Angstkampagnen gegen „Überfremdung“ bekam. Die Flüchtlingskrise wurde zur „Zerreißprobe“ für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und prägte die folgenden Wahlen – 2016 scheiterte beinahe ein rechtspopulistischer Kandidat (Norbert Hofer) nur knapp bei der Bundespräsidentenwahl, 2017 gewann die ÖVP-FPÖ Koalition unter dem Motto strenger Migrationspolitik.
Faktisch haben Migration und Diversität Österreich nachhaltig verändert: Im Jahr 2022 hatte bereits etwa ein Viertel der Bevölkerung Migrationshintergrund (rund 2,5 Millionen Menschen)orf.atorf.at. Der Anteil der im Ausland geborenen Einwohner erreichte 2024 etwa 27,8 %, gegenüber 21,4 % im Jahr 2015orf.at. Ohne Zuwanderung würde Österreichs Bevölkerung heute schrumpfen – das Bevölkerungswachstum der letzten Jahrzehnte beruht ausschließlich auf Migrationorf.atorf.at. Die größten Zuwanderergruppen kommen aus Deutschland, Rumänien, Türkei, Serbien sowie neuerdings Syrien und der Ukraineorf.at. Diese Vielfalt spiegelt sich in den Schulen, am Arbeitsmarkt und im Stadtbild wider. Wien ist heute eine multiethnische Metropole, in der knapp die Hälfte der Einwohner im Ausland geboren ist.
Politisch hat das Thema Migration immer wieder Kontroversen ausgelöst: Schon 1993 organisierte die FPÖ unter Haider das Volksbegehren „Österreich zuerst“ gegen Überfremdung, das 416.000 Unterschriften bekam – ein erster Indikator für fremdenfeindliche Stimmungen. Die Regierungen reagierten mit teils restriktiveren Ausländergesetzen (1992, 1997). Ab den 2000ern entstand langsam eine Integrationspolitik: 2010 wurde ein Staatssekretariat (später Bundesministerium) für Integration geschaffen, Integrationkurse und Deutschtests eingeführt. Dennoch bleibt das Spannungsfeld groß: Ein Teil der Gesellschaft fordert Offenheit und sieht Diversität als Bereicherung, ein anderer Teil fürchtet Identitätsverlust und Belastungen für den Sozialstaat. Insbesondere das Zusammenleben mit der muslimischen Minderheit (etwa 8 % der Bevölkerung 2021statistik.atstatistik.at) ist Dauerthema – von Debatten über das Kopftuch in Schulen bis zu Fragen der Parallelgesellschaften. Die Regierung versuchte 2017 ein Kopftuchverbot für Volksschulkinder, das jedoch 2020 vom Verfassungsgerichtshof als diskriminierend aufgehoben wurdevfgh.gv.at.
Trotz aller Probleme zeigen Umfragen auch Positives: Eine Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund fühlt sich Österreich mittlerweile stärker verbunden als ihrem Herkunftslandorf.at. Viele ehemals Fremde sind zu Mitbürgern geworden – sichtbares Zeichen sind etwa die tausenden Eingebürgerten jährlich (auch wenn die Einbürgerungskriterien streng bleiben: meist 10 Jahre Aufenthalt und Verzicht auf alte Staatsbürgerschaft). Integration erfolgt vor allem im Bildungswesen und am Arbeitsmarkt. Hier besteht Aufholbedarf: Personen mit ausländischen Wurzeln sind überdurchschnittlich oft gering qualifiziert oder arbeitslos. Doch es gibt auch Erfolgsgeschichten – vom Gastarbeiterkind zum Unternehmer oder Minister (z.B. Justizministerin Alma Zadić mit bosnischer Herkunft). Insgesamt hat Österreich den Wandel zu einer Einwanderungsgesellschaft durchlebt, nicht reibungsfrei, aber doch ohne größere sozialen Unruhen. Der gesellschaftliche Diskurs darüber bleibt emotional – er trennt gewissermaßen das „Insel der Seligen“-Narrativ (harmonisches Miteinander) von einem „Land ohne Eigenschaften“, in dem es an klarem Zugehörigkeitsgefühl mangelt. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob es gelingt, ein inklusives nationales Wir-Gefühl zu entwickeln, das die Diversität als Teil der österreichischen Identität annimmt.
Bildung, Wissenschaft und Innovationskultur
In der Bildungspolitik vollzog Österreich nach 1945 den Übergang von einem elitären zu einem durchlässigeren System – allerdings langsamer als manche Nachbarn. Die Kreisky-Regierung forcierte ab 1970 umfassende Bildungsreformen: Einführung der Schulbuch-Aktion (Gratis-Schulbücher) und der Schülerfreifahrt, Ausbau der Schulen im ländlichen Raum, v.a. aber der freie Hochschulzugang (1972 Abschaffung der Studiengebühren). Kreisky gründete zudem 1975 ein eigenes Wissenschaftsministerium (unter Hertha Firnberg), was Forschung und Hochschulen politisch aufwertetede.wikipedia.org. In dieser Ära stieg die Zahl der Maturanten und Studierenden sprunghaft – Bildung wurde breiteren Schichten zugänglich („Chancenausgleich“). Österreich hatte also seine bildungspolitische Insel-der-Seligen-Phase, in der großzügig investiert wurde und Aufbruchsstimmung herrschte.
Doch nicht alle Ziele wurden erreicht: Der Plan, das strikte duale Schulsystem aus Gymnasium vs. Hauptschule zugunsten einer Gesamtschule zu überwinden, scheiterte am Widerstand konservativer Kräfte (das bis heute bestehende frühe Trennen der 10-Jährigen nach Volksschule ist ein umstrittener Punkt geblieben). In den 1980ern und 90ern stagnierte vieles; es war von „Reformstau“ die Rede. Erst die PISA-Schocks um 2000 – mittelmäßige Testergebnisse der 15-Jährigen – führten zu Umdenken und kleineren Reformen (z.B. Neue Mittelschule statt Hauptschule, standardisierte Matura). International liegt Österreichs Schulsystem nach wie vor im Mittelfeld: solide Grundbildung, aber weiterhin starke Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom Elternhaus. Dieses Problem versucht man jüngst mit Ausbau der Ganztagsschulen und elementarpädagogischen Reformen anzugehen.
Im Hochschulsektor wechselte die Politik mehrfach: Nach 2001 wurden Studiengebühren wieder kurzfristig eingeführt (ÖVP-FPÖ), später aber teils erlassen oder durch Zugangsbeschränkungen ersetzt. Die Universitäten erhielten 2002 mehr Autonomie (UG 2002), was eine Modernisierung brachte. Wissenschaftlich hat Österreich in einigen Bereichen Tradition (z.B. Quantenphysik mit Nobelpreisträger Zeilinger, Klimaforschung mit IPCC-Beteiligung) und seit EU-Beitritt auch Zugang zu europäischen Forschungsprojekten. Dennoch galt lange ein gewisses Anti-Intellektualismus-Klischee: populäre Kultur wurde höher geschätzt als akademische. Das hat sich gewandelt – nicht zuletzt, weil Innovation als Wirtschaftsargument erkannt wurde.
Die Innovationskultur des Landes hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verbessert: Die F&E-Ausgaben wurden kontinuierlich gesteigert. Österreich übertrifft seit 2011 jedes Jahr das EU-Ziel von 3 % Forschungsquote gemessen am BIPbmb.gv.atbmb.gv.at. 2020 lag die Forschungsquote bei ~3,2 %, dem dritthöchsten Wert in der EU (nach Schweden und Belgien)bmb.gv.at – in den 1980ern war sie noch deutlich niedriger. Diese Investitionen – gefördert etwa durch die steuerliche Forschungsprämie – haben ein dynamisches Start-up- und Technologie-Umfeld begünstigt. Wien und Graz entwickeln sich zu Zentren für IT und Life Sciences, Linz für Digitalisierung und Industrie 4.0. In internationalen Innovationsrankings gehört Österreich inzwischen zur erweiterten Spitzengruppe. Gleichzeitig bleibt die Bildungskultur ambivalent: Während in der Spitzenforschung viel erreicht wird, gibt es in der Breite Herausforderungen (z.B. Lehrlingsmangel, digitale Kompetenzen an Schulen).
Kulturell ist die Wertschätzung von Bildung gestiegen – mehr junge Leute machen Matura als je zuvor, und ein Studium ist für viele selbstverständlich geworden. Allerdings klagen Arbeitgeber über Fachkräftemangel in technischen Berufen; umgekehrt gibt es für Uni-Absolventen nicht immer passende Jobs im Land, was zu Brain-Drain führen kann. Ein „Land ohne Eigenschaften“ ist Österreich in Sachen Bildung sicher nicht: Man hat eine solide Basis geschaffen. Aber ob man eine „Insel der Seligen“ mit Weltklasse-Schulen und Universitäten ist, darf bezweifelt werden – dazu besteht zu viel Reformbedarf (Stichwort: frühe Selektion, geringe soziale Durchmischung). Die Innovationskultur zeigt jedoch, dass Österreich durchaus zu kontinuierlicher Verbesserung fähig ist, wenn ein Ziel politisch priorisiert wird (wie die Steigerung der Forschungsleistung). Zusammenfassend: Vom einst kaiserlich-konservativen Bildungssystem hat sich Österreich zu einer moderneren Wissensgesellschaft gewandelt, auch dank Kreiskys Grundlagenarbeit. Es gilt aber weiter, Bildungsgerechtigkeit herzustellen und Innovationsgeist breit zu verankern, damit das Land im globalen Wettbewerb nicht an Profil verliert.
Medienlandschaft, öffentlicher Diskurs und Polarisierung
Die österreichische Medienlandschaft ist geprägt von einigen Besonderheiten: Ein kleiner Markt mit ungewöhnlich reichweitenstarken Boulevardmedien und einem großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Kronen Zeitung etwa war jahrzehntelang mit Abstand die meistgelesene Tageszeitung; 2005 lasen fast die Hälfte aller Österreicher die Krone – relativ zur Einwohnerzahl ein Weltrekorddiemedien.at. Bis heute erreicht sie, gedruckt und online kombiniert, täglich etwa 28 % der Bevölkerungdiemedien.at. Diese Stellung macht die Krone zum „politisch einflussreichsten und gefürchtetsten Medium“ des Landesdiemedien.atdiemedien.at. Über Jahrzehnte trieb sie mit Kampagnen die Regierungspolitik vor sich her und konnte Politiker stürzen oder Projekte verhindern. „Noch immer fürchten Österreichs Regierende den Boulevardriesen, der geschickt Wut schürt. Man versucht, die Krone (und andere Boulevardmedien) mit Informationen und öffentlichem Werbegeld freundlich zu stimmen.“diemedien.at Diese Aussage illustriert die ungesunde Nähe zwischen Politik und Medien, die sich z.B. in der sogenannten Inseratenaffäre (ÖVP unter Kurz) widerspiegelte: Staatliche Inserate wurden an bestimmte Medien vergeben, wofür man im Gegenzug wohlwollende Berichterstattung erwartete. Solche Verflechtungen beschädigen die Pressefreiheit und wurden in den letzten Jahren verstärkt thematisiert.
Neben der Krone gibt es weitere Boulevardzeitungen (Heute, Österreich/Oe24), die ebenfalls hohe Auflagen erzielen, aber oft für populistische und polarisierende Berichterstattung kritisiert werden. Auf der anderen Seite stehen Qualitätsmedien wie Der Standard (liberal), Die Presse (bürgerlich-konservativ) oder profil (Wochenmagazin), die einen faktenorientierten Journalismus pflegen. Doch deren Reichweiten sind deutlich geringer. Der öffentlich-rechtliche ORF hat als landesweiter Broadcaster einen Bildungs- und Integrationsauftrag und genießt relativ großes Vertrauen – war aber auch immer Objekt parteipolitischer Einflussnahme (die Besetzung von Führungspositionen nach Proporz ist legendär). Bis in die 1990er hatte der ORF Quasi-Monopol im TV; mit Privat-TV (ATV, Puls4) und besonders dem Aufstieg von ServusTV in den 2010ern kam Konkurrenz. ServusTV, im Besitz von Red Bull, positionierte sich mitunter als Anti-Mainstream-Stimme (etwa kritisch gegenüber Corona-Maßnahmen).
Die Digitalisierung hat das Medienverhalten radikal verändert: Online-News und soziale Medien (Facebook, YouTube) spielen heute eine riesige Rolle im öffentlichen Diskurs. Dies ermöglichte neue Stimmen – positive wie negative. So entstanden alternative Plattformen, Blogs und auch verschwörungstheoretische Kanäle, die während der Pandemie viele Anhänger fanden. Die Folge ist eine stärkere Fragmentierung der Öffentlichkeit: Früher gaben einige Leitmedien den Ton an, heute existieren „Echoräume“ für jedes Lager. Studien belegen, dass die selektive Mediennutzung die gesellschaftliche Spaltung verstärkt hat, etwa in der Corona-Fragescience.apa.atscience.apa.at. Konsumierten Menschen vorwiegend ORF-Nachrichten, schätzten sie Covid-19 als gefährlicher ein und befürworteten Maßnahmen eher; wer hauptsächlich ServusTV-Kommentare wie „Der Wegscheider“ sah, neigte zu Verharmlosung und Ablehnung der Maßnahmenscience.apa.atscience.apa.at. Durch Confirmation Bias verstärkten sich bestehende Einstellungen wechselseitig – ein „Aufschaukeln“, das laut Kommunikationsforschung zur Polarisierung der Gesellschaft beitrugscience.apa.at.
Bereits vor Corona gab es Anzeichen erhitzter Debatten: Themen wie Migration (2015), EU oder Klimaschutz führten zu teils hasserfüllten Online-Kommentaren. Im klassischen Medienbetrieb versucht man gegenzusteuern – z.B. durch Moderation von Foren, Faktenchecks, aber auch durch mehr Meinungsvielfalt auf den Kommentar-Seiten. Trotzdem ist ein Anstieg von Medien-Skepsis spürbar, gerade bei Anhängern rechter Parteien. Begriffe wie „Lügenpresse“ fanden zwar nie so weite Verbreitung wie in Deutschland, aber Umfragen zeigen, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung den „etablierten Medien“ skeptisch gegenüberstehtoe1.orf.at. Die Pandemie hat diese Grundskepsis weiter verschärftoe1.orf.at. Für die Demokratie ist das eine Herausforderung: Ohne gemeinsamen Informationskern wird der rationale Diskurs schwierig.
Dennoch gibt es positive Entwicklungen: Die Medienvielfalt ist trotz Konzentration vorhanden, investigative Journalist:innen (z.B. Bastian Obermayer, der die Ibiza-Affäre Video veröffentlicht hat) leisten wichtige Aufklärung, und Initiativen zur Medienbildung sollen Bürgern helfen, Desinformation zu erkennen. Österreichs Pressefreiheit rangiert laut Reporter ohne Grenzen im soliden Mittelfeld, wenngleich die Nähe zwischen Politik und Boulevard immer wieder Kritik hervorruft. Öffentlich ausgetragene Polarisierung gehört inzwischen fast zum Alltag – etwa wenn bei ORF-TV-Duellen oder in ZiB 2-Interviews harte Wortgefechte stattfinden, was es in den „konsensseligen“ Jahrzehnten davor kaum gab. Dieser schärfere öffentliche Diskurs kann als Zeichen einer normalisierten, pluralistischen Demokratie gesehen werden – oder als gefährliche Erosion des einstigen gesellschaftlichen Zusammenhalts. Vermutlich trifft beides zu einem gewissen Grad zu. Jedenfalls ist die Zeit, in der Österreichs Medienwelt überschaubar und halbwegs kontrolliert war (Insel der Seligen im Sinne von Ruhe), vorbei. Stattdessen spiegelt sie nun die ganze Widersprüchlichkeit des „Landes ohne Eigenschaften“: vielfältig, aber auch unübersichtlich; mit großem kritischem Potenzial, aber zugleich anfällig für Stimmungsmache.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt und nationale Identität
Die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zieht sich wie ein roter Faden durch die Zweite Republik. Nach 1945 bestand eine große Einigkeit, das verwüstete Land gemeinsam wiederaufzubauen – die politische Lagerbildung (Rot vs. Schwarz) wurde durch die Koalitionen gezähmt, gemeinsame Feindbilder (z.B. der Kommunismus im Kalten Krieg) schweißten zusammen. Dieses „Wir-Gefühl“ der frühen Zweiten Republik basierte freilich auch auf Ausgrenzung (ehemalige Nazis wurden zunächst ausgespart oder integriert ohne viel Aufhebens) und auf der erwähnten Opferrolle. Dennoch: Die hohe soziale Sicherheit und der national geteilte Wohlstand (bis weit in die Mittelschicht hinein) sorgten für ein Gefühl der Geborgenheit. Der Begriff „Insel der Seligen“ spielte genau darauf an – ein Land, das von den stürmischen Wellen außenrum verschont bleibt und in dem ein Großteil der Bürger sich aufgehoben fühltde.wikipedia.org. Dieses Selbstbild zeigte sich z.B. in der beliebten Redewendung „Haben wir es nicht gut in Österreich?“ – implizierend, dass es anderswo viel schlechter sei. Tatsächlich gehörten Indikatoren wie Lebensstandard, Arbeitsfrieden und Wohlstandsverteilung in den 60er/70er Jahren zu den besten weltweit. Österreich war homogener als heute: kulturell (über 90 % Katholiken), ethnisch (kaum Zuwanderung bis auf Gastarbeiter, die erst langsam sichtbar wurden), sprachlich (fast ausschließlich Deutsch, abgesehen von kleinen Minderheiten in Kärnten, Burgenland) – all das erleichterte einen gewissen Konsens über Werte und Lebensweise.
Doch mit dem gesellschaftlichen Wandel ab den 1980ern traten Bruchlinien hervor: Stadt vs. Land, Linksliberal vs. Rechtskonservativ, „Altösterreicher“ vs. Neueinwanderer. Der Zusammenhalt wurde durch Diversität auf die Probe gestellt, aber auch durch wirtschaftliche Entwicklungen (steigende Arbeitslosigkeit in den 1980ern gegenüber Vollbeschäftigung in den Nachkriegsjahrzehnten). Die 2000er Jahre brachten dann eine Politisierung entlang neuer Konfliktlinien: globalisierungskritische Bewegungen vs. Neoliberale, EU-Befürworter vs. EU-Skeptiker, Traditionalisten vs. Kosmopoliten. Während früher SPÖ und ÖVP zusammen über 90 % Wähleranteil hatten (ein Zeichen, dass fast alle im großen Zelt Platz fanden), fiel ihr Anteil unter 60 %, und neue Parteien fragmentierten das Feld. Gesellschaftlicher Zusammenhalt muss seither neu ausgehandelt werden.
Dennoch zeigt sich Solidarität in Krisen immer noch stark: Bei Naturkatastrophen (Hochwässer, Lawinen) oder zuletzt in der Flüchtlingskrise 2015 haben viele Österreicher spontan geholfen. Überhaupt ist das Ehrenamt im internationalen Vergleich hoch entwickelt (Freiwillige Feuerwehren, Rettungswesen, Sport- und Kulturvereine). Dieses dichte Vereinsleben – oft getragen von Kirche oder Gemeinden – fungiert als sozialer Kitt. Auch während der Corona-Pandemie hielten die meisten sich an Regeln zum Schutz der Mitmenschen; die Polarisierung betraf zwar die öffentliche Debatte, aber die Mehrheit agierte durchaus rücksichtsvoll (Impfquote schließlich um 75 % bei Erwachsenen). Allerdings hat Corona auch Risse aufgezeigt: eine lautstarke Minderheit fühlte sich ausgegrenzt und radikalisierte sich teils (Demonstrationen mit rechtsextremer Beteiligung etc.).
Was die nationale Identität betrifft, so hat Österreich einen interessanten Wandel durchlaufen: 1945 fühlten sich viele noch als „Deutsche“ im kulturellen Sinn. Doch durch die Abgrenzung nach dem Krieg und den Erfolg des eigenen Staates entwickelte sich in wenigen Jahrzehnten eine starke österreichische Identität. In Umfragen bezeichnen sich heute die meisten als „Österreicher, nicht Deutsche“ – eine enorme Veränderung gegenüber 1945. Literaten wie Robert Menasse sprachen 1992 zwar von einem „Land ohne Eigenschaften“, das seine Identität nie aktiv gestaltet, sondern aus Zufällen ableitetkatalog.borgmistelbach.ac.at. Doch faktisch gibt es zahlreiche Eigenschaften, die Bürger als typisch österreichisch ansehen: vom Hang zur Gemütlichkeit und dem Wert der Lebensqualität, über kulturelle Traditionen (Musik, Kaffeehaus, Kulinarik) bis hin zu politisch-sozialen Besonderheiten (Neutralität, Sozialpartnerschaft). Gerade der EU-Beitritt 1995 hat interessanterweise nicht zu einer Auflösung der Identität geführt, sondern eher zu deren Festigung im Unterschied zu den Deutschen. Die Österreicher sind heute stolz auf ihr eigenes Land (in Umfragen sehr hohe Zufriedenheitswerte mit dem „Land, in dem man lebt“). Allerdings gibt es zugleich Sub-Identitäten (z.B. starke Bundesländer-Patriotismen – Tiroler, Steirer etc. – oder Migrationsgruppen, die Herkunftsbezüge pflegen).
Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird aktuell v.a. durch soziale Ungleichheit und politische Polarisierung strapaziert: Die Schere zwischen arm und reich hat sich leicht geöffnet (wenn auch weniger als anderswo in der EU, dank Umverteilung). Politisch ist das Land gespalten in ein eher kosmopolitisches, urbanes Lager und ein eher traditionell-nationales, peripheres Lager – was sich in Wahlergebnissen (Stichwort Bundespräsidentenwahl 2016: Westliches, städtisches Österreich grün, ländlicher Norden blau) ablesen ließ. Dennoch funktioniert das Alltagsleben friedlich; es gibt keine unüberbrückbaren Fronten im zivilen Miteinander.
Zusammengefasst: Der innere Zusammenhalt Österreichs war lange außergewöhnlich hoch – fast idyllisch –, steht aber in jüngerer Zeit vor Erprobungen. Manche fürchten, das Land verliere seinen kleinteiligen Charme und driftet auseinander (*„Land ohne Eigenschaften“ im Sinne von Orientierungsverlust). Andere betonen, Österreich habe schon oft bewiesen, dass es Zusammenhalt neu stiften kann – nach 1945, nach 1986 (Waldheim), auch nach Corona wird es Wege finden. Die gemeinsame Geschichte (von der Habsburgerzeit bis zur Moderne) bietet jedenfalls genug narrativen Stoff, um ein verbindendes Wir-Gefühl zu nähren. Ob die kommenden Generationen dies annehmen, wird sich zeigen.
Wandel durch Globalisierung und EU-Mitgliedschaft
Globalisierung und der EU-Beitritt 1995 bilden eine weitere Schlüsseldimension in der Entwicklung Österreichs. Jahrzehntelang lag das Land am Rand der „westlichen Welt“, abgeschottet durch den Eisernen Vorhang nach Osten. Die Wirtschaft war bis in die 1980er relativ geschützt: Der Staat betrieb großen Anteil der Industrie (Verstaatlichte Industrie in Stahl, Chemie, Öl etc.), Handel und Kapitalverkehr waren reguliert. Globalisierung bedeutete hier zunächst: 1970er Ölkrisen und 1980er Strukturwandel brachten Arbeitslosigkeit, aber Österreich reagierte mit aktiver Strukturpolitik (Verstaatlichte stützen, neue Industriezweige fördern). In dieser Phase konnte man sich fast eine Insel-Mentalität leisten – die österreichische Wirtschaft (oft Austria AG genannt) war ein in sich geschlossener Kosmos, Sozialpartnerschaft und Staat lenkten viel. Bruno Kreisky finanzierte z.B. Vollbeschäftigung auch durch Schulden, um die globale Rezession abzufedern.
Mit den späten 1980ern änderte sich das rapide: Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 öffnete gewaltige Chancen – österreichische Firmen expandierten nach Osteuropa (Banken, Bau, Handel – z.B. Raiffeisen Bank, Strabag, Erste Bank – eroberten Märkte in Ungarn, Tschechien, später Balkan). Gleichzeitig kam Wettbewerb ins Land: Billigere Produkte aus dem Ausland, internationale Konzerne, die sich ansiedelten (etwa deutsche Handelsketten). Die EU-Mitgliedschaft ab 1995 besiegelte diese Integration: Binnenmarkt, Wegfall der Zölle, gemeinsamer Euro (Österreich führte 2002 den Euro ein). Anfangs gab es Ängste vor Preissteigerungen und Übernahme heimischer Betriebe durch Ausländer. Teils traf das ein – etwa wurden Traditionsunternehmen von Multis gekauft. Doch unterm Strich profitierte Österreich enorm: Der EU-Beitritt brachte zusätzliches Wirtschaftswachstum, Exportrekorde (besonders nach Deutschland und in die neuen osteuropäischen EU-Länder) und Direktinvestitionen. Die Arbeitslosenquote blieb bis in die 2010er relativ niedrig im EU-Vergleich. Strukturelle Veränderungen fanden allerdings statt: Viele staatsnahe Betriebe wurden privatisiert (Voestalpine, Telekom, Banken), manche Branchen bauten massiv Personal ab (Bergbau, Textilindustrie gingen fast ganz verloren). Dafür entstanden neue Jobs im Dienstleistungssektor, Tourismus und High-Tech.
Gesellschaftlich führte die Globalisierung zu einer gewissen Verunsicherung bei Teilen der Bevölkerung – ein Nährboden für populistische Kritik (die FPÖ agitierte gegen „Ausverkauf der Heimat“ oder EU-Bürokratie). 1994 stimmten aber 66,6 % der Österreicher für den EU-Beitrittde.wikipedia.org, ein deutliches Votum. Die Unterstützung zur EU pendelt seither, war aber meist positiv. Krisen wie die Eurokrise 2008 oder Migrationskrise 2015 minderten das Vertrauen phasenweise, doch ein Öxit war nie ernsthaft in Sicht. Vielmehr ist Österreich im EU-Mehrauen-Verbund oft pragmatisch: man macht mit, soweit es nützt, und pflegt zugleich eine gewisse Schmollecke (etwa bei Nettozahlungen oder landwirtschaftlichen Quoten). Der EU-Beitritt war jedenfalls ein epochaler Einschnitt: Er bedeutete das Ende einer teilweise provinziellen Selbstgenügsamkeit. Österreich musste plötzlich europäische Verantwortung mittragen – z.B. presidierte man 1998 erstmals den EU-Rat, stieß Initiativen an (Osterweiterung mitgestaltet, Umweltstandards etc.). Die Bevölkerung profitierte auf der Mikroebene: Reisefreiheit, Studium im Ausland (Erasmus-Programm), keine Roaming-Gebühren – viele jüngere Menschen sind durch die EU weltgewandter. Globalisierung zeigt sich auch in der Präsenz internationaler Konzerne (McDonald’s bis Tesla) und Kultur (Hollywood-Filme verdrängten lange das heimische Kino, Streaming heute ohnehin global). Das ruft einerseits Kosmopoliten auf den Plan, andererseits Traditionalisten, die das „Österreichische“ bewahren wollen.
Im Kontext „Insel der Seligen vs. Land ohne Eigenschaften“ lässt sich sagen: Die Globalisierung riss Österreich aus seinem Dornröschenschlaf. Die Insel wurde ans Festland angebunden, was neuen Wohlstand, aber auch neue Wettbewerbshärte brachte. Einige meinen, Österreich habe dabei Profil verloren – man sei austauschbar geworden in der EU, ein kleines Rädchen ohne eigene Eigenschaften. Dagegen halten andere, Österreich hätte seine Spezifika klug genutzt: z.B. als Vermittler zwischen Ost und West (Erweiterung), als Vorkämpfer für bestimmte Themen (Umwelt: Österreich war etwa gentechnik-kritisch und stark in erneuerbaren Energien engagiert) oder als Hort hoher Lebensqualität, was im globalen Wettbewerb Talente anzieht.
Fakt ist: Die österreichische Wirtschaft und Gesellschaft sind heute stark global verflochten. Ereignisse in der Welt (Finanzkrisen, Pandemien, Kriege) wirken unmittelbar hier. Das Land hat in der Globalisierung eine robuste Position erarbeitet – gemessen am BIP pro Kopf gehört es global zur Top-Liga, ebenso im Globalisierungindex. Aber die Kehrseite sind neue Abhängigkeiten (Gasimporte, internationale Spekulanten – siehe Hypo-Alpe-Adria-Bank-Desaster mit BayernLB) und der Verlust mancher Sicherheiten, die früher selbstverständlich waren (etwa eine Stelle auf Lebenszeit im öffentlichen Dienst – heute ist die Arbeitswelt flexibler, unsicherer geworden). Unterm Strich ist Österreich vom behüteten Binnenland zu einem offenen Player geworden. Das Selbstbild hat sich entsprechend angepasst: Man sieht sich als Teil Europas, aber mit eigenem Charme. Bruno Kreiskys Ausspruch, „Lernen Sie ein bissel Geschichte, Herr Reporter!“, zeugt von Selbstbewusstsein – heute könnte man hinzufügen: und lernen Sie Englisch, Digitalisierung, Change-Management. Österreich hat sich verändert und musste lernen, sich immer wieder neu zu definieren in der globalen Ära. Dabei half es, dass man auf einem starken Fundament stand (Rechtsstaat, Wohlstand, Sozialsystem) – nicht jedes Land hatte diesen Luxus. Vielleicht war die Insel also gut gerüstet, um auch angeschlossen noch zu florieren.
Rolle von Religion und Kirche
Die katholische Kirche spielte in Österreich traditionell eine überragende Rolle. 1945 war rund 90 % der Bevölkerung römisch-katholischstatistik.at; der Katholizismus war Teil der nationalen Identität und wurde vom konservativen Lager politisch vertreten (ÖVP als „christliche Partei“). Der Wiederaufbau der Zweiten Republik geschah in einer Werteordnung, die stark christlich-sozial geprägt war – Kirche und Staat arbeiteten kooperativ (Konkordat blieb in Kraft, Religionsunterricht an Schulen etc.). Bis in die 1980er war Österreich ein Land mit hoher Kirchgängerquote und gesellschaftlicher Macht der Kirche. Beispielsweise wurde 1971 ein liberaleres Fristenlösungs-Abtreibungsrecht unter SPÖ-Kanzler Kreisky gegen heftigen kirchlichen Widerstand eingeführt; dies zeigte erstmals einen Riss zwischen säkularer Politik und kirchlichem Einfluss.
Säkularisierung schritt in den folgenden Jahrzehnten schnell voran. Der Anteil der Katholiken sinkt seither kontinuierlich: 2021 waren nur noch 55 % der Bevölkerung offiziell Mitglieder der römisch-katholischen Kirchestatistik.at, Ende 2022 etwa 52 %, und Prognosen gehen davon aus, dass um 2025/26 die Katholiken unter 50 % fallen werdenmeinekirchenzeitung.at. Parallel dazu stieg der Anteil der Konfessionslosen auf rund 22 % (2021)statistik.atstatistik.at. Zugleich nahm die religiöse Pluralität zu: Durch Zuwanderung gibt es inzwischen etwa 8 % Muslime und knapp 5 % Orthodoxe Christen im Landstatistik.atstatistik.at – Gruppen, die 1950 praktisch inexistENT in Österreich waren. Die evangelische Kirche (Lutheraner) hingegen schrumpfte von ~6 % in den 1950ern auf unter 4 % heutestatistik.at.
Die katholische Kirche selbst durchlief interne Krisen. 1995 forderten beim berühmten „Kirchenvolks-Begehren“ über 500.000 Gläubige Reformen (Zölibat lockern, mehr Rechte für Laien etc.), was die Hierarchie aber nur begrenzt erhörte. Fälle von Kirchenmissbrauch und Skandale (der Rücktritt von Kardinal Groër 1995 nach Missbrauchsvorwürfen) erschütterten das Vertrauen vieler Gläubigen. Jährlich treten zehntausende Katholiken aus der Kirche aus – ein Zeichen, dass die Institution an Bindekraft verliert. Dennoch bleibt die Kirche gesellschaftlich sichtbar: Caritas und andere kirchliche Organisationen sind große Player im Sozialbereich, und bei Themen wie Flüchtlingshilfe 2015 ergriff die Kirche (allen voran Kardinal Schönborn) Partei für humane Lösungen. Religion im Alltag ist jedoch privater geworden: Immer weniger Menschen besuchen regelmäßig die Messe; Glaube ist vielfältiger (es gibt Esoterik-Trends, oder individuelle Spiritualität).
Die Politik hat sich dem Wandel angepasst: War in den 1950ern noch selbstverständlich, dass Spitzenpolitiker sonntags im Stephansdom gesehen wurden und der Staatsvertrag 1955 wurde mit einem feierlichen Te Deum gefeiert, so ist heute Politik stärker laizistisch. Offene Konflikte zwischen Staat und Kirche gab es selten – etwa 2009 beim Thema Ethikunterricht vs. Religionsunterricht oder jüngst beim Kopftuchverbot (wo religiöse Freiheit vs. Integrationsgedanke debattiert wurde). Generell herrscht ein friedliches Nebeneinander: Die Kirchen sind durch Gesetz (Staatsvertrag 1961) geschützt und finanziell unterstützt, mischen sich aber inhaltlich moderat ein.
Eine interessante Entwicklung ist die wachsende Sichtbarkeit des Islam: Mit rund 700.000 Muslimen (viele mit türkischen oder bosnischen Wurzeln) ist der Islam nach dem Katholizismus die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft. Österreich hat seit 1912 (Islamgesetz) eine anerkannte islamische Religionsgesellschaft, was Integration erleichtern sollte. Dennoch sind Themen wie Moscheebau, islamischer Unterricht und Radikalisierung (Stichwort einige junge Österreicher als IS-Kämpfer um 2015) Dauerbrenner. Die Regierung reagierte mit strengeren Gesetzen (Islamgesetz-Novelle 2015 verbot Auslandsfinanzierung von Imamen) und Überwachung extremistischer Tendenzen. Gleichzeitig funktionieren in der Praxis viele muslimische Gemeinden gut integriert, und islamische Feiertage sind in manchen Schulen selbstverständlich geworden.
Die katholische Kirche sucht derweil nach neuer Rolle: Sie versucht, als Wertevermittlerin in einer pluralistischen Gesellschaft aufzutreten. Papstbesuche (Johannes Paul II. 1983 und 1998, Benedikt XVI. 2007) waren noch große Ereignisse, aber die Volkskirche von einst verwandelt sich in eine von vielen gesellschaftlichen Gruppen. 2023 wurde erstmals diskutiert, kirchliche Feiertage zu reduzieren, da immer weniger Gläubige sie begründen – das zeigt, wie sehr die Zeiten sich geändert haben.
In Summe: Österreich war ehemals nahezu deckungsgleich mit katholisch. Heute ist es religiös vielfältig und säkularer denn je. Das traditionelle Motto „Gott erhalte“ (aus der Hymne der Monarchie) hat an Verbindlichkeit verloren. Für manche bedeutet das einen Verlust an Halt (Stichwort „Land ohne Eigenschaften“, dem ein spirituelles Fundament abhandenkommt). Andererseits eröffnet es Raum für neue Identitäten: Österreich definiert sich jetzt stärker über Werte wie Demokratie, Menschenrechte, Kulturleistungen – nicht mehr primär religiös. Die Kirche ist nicht mehr dominanter Akteur, aber immer noch Teil des sozialen Friedens (Stichwort Pfarrgemeinden als Nachbarschaftszentren). In Krisenzeiten wird durchaus auf sie gehört, doch die Meinungen sind divers. Ein Indiz der Veränderungen: 2022 gaben nur 33 % der Wiener an, religiös zu seinstatistik.at – die Mehrheit in der Hauptstadt ist säkular. Österreich hat also in 80 Jahren den Schritt vom katholisch geprägten „Heiligen Land“ (Insel der Seligen im frommen Sinn) zu einer säkular-pluralen Gesellschaft geschafft, in der Religion Privatsache und eine von vielen Facetten ist.
Fazit: Insel der Seligen oder Land ohne Eigenschaften?
Die Entwicklung Österreichs von 1945 bis 2025 zeigt ein Land im Spannungsfeld zwischen selbstzufriedenem Idyll und identitätssuchender Moderne. In der Nachkriegszeit konnte Österreich tatsächlich vieles verwirklichen, was Bruno Kreisky zur „Insel der Seligen“ verklärt hat – soziale Sicherheit, Neutralität, Zusammenhalt – ein Sonderfall positiver Artde.wikipedia.org. Doch diese Idylle basierte zum Teil auf Ausblendung von Konflikten und Vergangenheit. Spätestens ab den 1980er-Jahren wurde offensichtlich, dass Österreich kein abgeschottetes Paradies ist: Es musste sich seinen historischen Schatten stellen (NS-Vergangenheit aufarbeiten), neue Konflikte austragen (um Zuwanderung, Umwelt, Korruption) und im globalen Umfeld bestehen. Dieser Prozess ging einher mit der Suche nach einer zeitgemäßen Identität. Robert Musils Diagnose vom „Land ohne Eigenschaften“ sollte bewusst wachrütteln: Nicht in selbstgefälliger Zufriedenheit zu verharren, sondern kritisch zu hinterfragen, wofür Österreich stehen willkatalog.borgmistelbach.ac.at.
Heute lässt sich sagen: Österreich ist weder nur selige Insel noch völlig profilloses Land. Es hat markante Eigenschaften – etwa die tief verankerte Demokratie und Sozialpartnerschaft, die hohe Lebensqualität, die kulturelle Vielfalt von Mozart bis Conchita Wurst, die landschaftliche Schönheit, die besondere historische Erfahrung als kleines neutrales Land zwischen Großmächten. Zugleich kämpft es mit Entwicklungen, die viele westliche Gesellschaften herausfordern: Polarisierung, Vertrauensverlust in Institutionen, demografischer Wandel, Integration einer pluralen Bevölkerung. Der ehemals kuschelige Konsensstaat ist streitlustiger geworden; das kann als Reifezeichen der Demokratie gesehen werden, bedeutet aber auch mehr Spannungen im Alltag.
Österreich 2025 hat gelernt, dass Selbstreflexion nötig ist, um nicht zum Land ohne Eigenschaften zu werden. Die Frage nach dem Selbstbild wird offen diskutiert – sei es in Feuilletons über „österreichische Seele“ oder im politischen Diskurs zwischen rückwärtsgewandter Nostalgie und progressiver Weltoffenheit. Im besten Fall vereint Österreich das Beste beider Pole: den humanen, sozialen Geist der „Insel der Seligen“ (Zugehörigkeit, Solidarität) mit der kritischen, lernfähigen Haltung eines Landes, das sich ständig neu erfindet und nicht auf einem Mythos ausruht. Die historischen Zäsuren – Kreisky-Ära, Waldheim-Affäre, EU-Beitritt, Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie – waren Prüfsteine, an denen Österreich gewachsen ist und sein Profil schärfen konnte.
Bruno Kreisky sagte einmal bescheiden: „Österreich ist nicht das Paradies, aber wir haben es ganz gut eingerichtet.“ Dieses „ganz gut eingerichtete“ Land hat in 80 Jahren immense Wandlungen durchlebt und steht dennoch vergleichsweise stabil da. Ob es selig oder eigenschaftslos in die Zukunft geht, hängt davon ab, wie es die kommenden Herausforderungen – Klimawandel, digitale Revolution, sozialen Zusammenhalt – meistert. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Österreich dazu fähig ist, Krisen in Chancen zu verwandeln und dabei seine Identität fortzuentwickeln. In diesem Sinne ist es weder Insel noch Land ohne Eigenschaften, sondern ein „Land mit Eigenschaften“ – geprägt von Geschichte und doch immer im Werden begriffen.
Quellen: Bruno Kreisky bezeichnete Österreich in den 1970ern als „Insel der Seligen“ im Kontext von Sozialstaat, Neutralität und sozialem Friedende.wikipedia.org. Robert Menasse kritisierte 1992 in Das Land ohne Eigenschaften die österreichische Identität als negativ geprägtkatalog.borgmistelbach.ac.at. Das Sozialpartnerschafts-Modell förderte den Ruf Österreichs als konfliktarmes Land mit kaum Streiksde.wikipedia.org, seine Bedeutung sank ab 2000 durch politischen Druckde.wikipedia.orgde.wikipedia.org. Die Aussage, ein gerechter Sozialstaat sei Fundament von Stabilität und Demokratieparlament.gv.at, entstammt einer Rede im Parlament. Die Neutralität ist tief in der Identität verankertde.wikipedia.org; trotz EU-Mitgliedschaft hält die Mehrheit daran festde.wikipedia.org. Die Waldheim-Affäre 1986 wirkte als Auslöser zur Aufarbeitung der NS-Zeitwiev1.orf.at; selbst Waldheim betonte später die Notwendigkeit, die Opferrolle aufzugebenwiev1.orf.at. Eine Werte-Studie 2021 zeigt hohen Demokratiewillen, aber wachsende Unzufriedenheit mit der Politikprofil.at. 2024 waren 27,8 % der Bevölkerung im Ausland geboren (2015: 21,4 %)orf.at. 2021 bekannten sich nur noch 55 % zur römisch-katholischen Kirchestatistik.at, während 8,3 % Muslime warenstatistik.at. Österreichs Forschungsquote liegt stabil über 3 % des BIP (2020 dritthöchste in EU)bmb.gv.at. Die Medienlandschaft ist zweigeteilt: reichweitenstarker Boulevard (Krone mit 28 % Tagesreichweite)diemedien.at mit großem politischem Einflussdiemedien.atund qualitativ hochwertige, aber weniger gelesene Medien. Studien zeigen, dass selektive Mediennutzung (ORF vs. ServusTV) Einstellungen in der Pandemie verstärkte und zur Polarisierung beitragen kannscience.apa.atscience.apa.at. All diese Aspekte untermauern das vielschichtige Bild der österreichischen Gesellschaft 1945–2025.
+ Quellen